



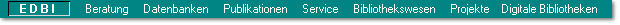




Uwe Jochum, Helmut Oehling
Ein populäres Credo des wissenschaftlichen Bibliothekswesens lautet: der höhere Dienst nimmt im wesentlichen Leitungsaufgaben wahr, während der Vollzug eher praktischer Abläufe auf den Schultern des gehobenen und mittleren Dienstes lastet. Dieses Credo in Frage zu stellen, ist, wie die drei Münsteraner Bibliothekare te Boekhorst, Buch und Ceynowa schreiben, "gefährlich", weil dadurch der im Bibliothekswesen notwendige "Paradigmenwechsel" (Digitalisierung, Virtualisierung, neue Managementkonzepte) behindert werde. Der Paradigmenwechsel erfordere nämlich eine "permanente Neuorientierung, Flexibilität und kreative Anpassung an sich stetig wandelnde Herausforderungen", und dazu brauche es den bibliothekarischen "Generalisten" im höheren Dienst, der dank seines Fachstudiums "hervorragende Voraussetzungen" mitbringe, um stets neuorientiert, flexibel und kreativ den digitalen und Management-Stier bei den Hörnern packen zu können.
Daß es sich so und nicht anders verhalte, zeige die Praxis, weshalb uns die Kollegen aus Westfalen einen Bericht über ihren Berufsalltag präsentieren, von dem sie reklamieren, er sei keineswegs "partikulär". Dank ihrer Teilnahme an IFLA- und DFG-Projekten seien sie nämlich in der bibliothekarischen Welt herumgekommen und stünden "in breitem Kontakt und Meinungsaustausch mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen in Hochschulbibliotheken innerhalb wie außerhalb Deutschlands"; und solchermaßen empirie- und kontaktgestärkt bescheinigen die drei unseren Analysen und Thesen "eine bedrückende Praxisferne". Der Eindruck einer unmittelbaren Evidenz der erlebten Praxis scheint dabei so stark zu sein, daß man in Münster nicht einmal mehr daran denkt, eine "theoretisch begründete Gegenposition" zu formulieren, um sich dann auf weitere Beiträge gefaßt zu machen und die Sache "auszudiskutieren".
Dieses Desinteresse an einer Diskussion über Sachverhalte unter Angabe von Gründen schlägt natürlich auf den gesamten Text unserer Kollegen zurück. Wenn es sich bei diesem Text nämlich nur um die Darstellung einer Praxis handelte, die wie weit auch immer verbreitet sein mag, dann würde die Darstellung dieser Praxis noch lange nichts über deren Richtigkeit aussagen: Was viele tun oder zu tun meinen, muß noch lange nicht das sein, was man tun sollte. Die Hinweise auf IFLA- oder DFG-Erfahrung sind daher wenig mehr als ein gewisser Imponier-Gestus, der dort einzusetzen pflegt, wo man mit Argumenten am Ende ist. Auf dieser Ebene des autoritativen Name-droppings könnte man dann höchstens noch jenes beliebte Kinderspiel spielen, das lautet: "Zeigst du mir deins, zeig ich dir meins."
Wir wollen daher nach gutem Hermeneutenbrauch die drei Münsteraner besser verstehen, als sie sich selbst verstanden haben, und nicht überlesen, daß sie entgegen ihren Intentionen in ihrem Beitrag Gründe nennen und sich also auf eine Diskussion einlassen, die alleine auf der Ebene von Argumenten entschieden wird. Prüfen wir, was sie sachlich mit Gründen zu sagen haben.
1. Management
Im Zentrum der Arbeit des höheren Dienstes stehen für unsere Münsteraner Kollegen Managementfunktionen, die in den Bibliotheken z. B. durch das "New Public Management" immer wichtiger würden. Diese Aufgaben könnten durch professionelle Manager nicht besser als durch Bibliothekare gelöst werden, wofür ein Beleg sei, daß bei der Analyse der ULB Münster durch ein Beratungsunternehmen die Berater zunächst durch die Bibliothekare hätten beraten werden müssen, um überhaupt beraten zu können. Beides zusammen, die Notwendigkeit einer Beratung der Berater wie die neuen Managementaufgaben, zeige, daß diese Aufgaben am besten von einer Mischform zwischen Fachreferent und Bibliotheksmanager wahrgenommen werden.
Nun wollen wir zusammen mit unseren Kollegen aus der Tatsache, daß man auch professionelle Managementberater zunächst einmal bibliothekarisch beraten muß, gerne schließen, daß man für eine sachgerechte Bibliotheksleitung ein Verständnis der bibliothekarischen Sachfragen haben muß. Daß diese "Mischform" von Sachkenntnis und Leitungskompetenz aber im Bibliothekswesen alleine im höheren Dienst zu finden sei, ist ein Schluß, der weder argumentativ einzusehen noch empirisch zu halten ist.
Wollte man das behaupten, müßte man darlegen können, wieso beispielsweise ein Studium der Romanistik mit nachfolgender Promotion und bibliothekarischem Referendariat zu einer ganz besonderen Leitungskompetenz führt. Umgekehrt müßte man dann auch zeigen können, wieso ein Fachhochschulstudium zu ebendieser Leitungskompetenz nicht führen kann. Bis diese Nachweise erbracht sind, wollen wir in aller Empirie darauf hinweisen, daß man außerhalb des wissenschaftlichen Bibliothekswesens mit der Klimax wissenschaftliches Studium = höherer Dienst = Leitungsaufgaben schon länger nichts mehr anzufangen weiß. So fahren die öffentlichen Bibliotheken mehrheitlich ja ganz gut auch ohne einen höheren Dienst und finden nichts dabei, einen Diplombibliothekar zum Bibliotheksleiter zu ernennen, der all das tut, was man in Münster nur dem höheren Dienst zutraut: neue Steuerungsmodelle implementieren, die Digitalisierung voranbringen, Sponsorengelder einwerben und die Bibliothek vor dem Gemeinderat vertreten.
Ganz schlimm muß es für Bibliothekare zwischen Lippe und Ems werden, wenn sie einen Blick über das enge Bibliothekssegment hinweg werfen. Denn dann müssen sie feststellen, daß nicht nur immer mehr Krankenhäuser von Fachhochschulabsolventen geleitet werden, sondern auch in der Kommunalverwaltung das Personal ganzer Ämter bis hinauf zur Leitung sich nur aus gehobenem und mittlerem Dienst rekrutiert. Und das alles, obwohl man dort mit ganz anderen personellen und finanziellen Ressourcen als in den Bibliotheken umzugehen gewohnt ist und länger schon als im Bibliothekswesen mit neuen Steuerungsmodellen hantiert.
Zählt man das alles zusammen, dann zeigt sich, daß unsere Münsteraner Kollegen nichts zu bieten haben als die Behauptung, die in den wissenschaftlichen Bibliotheken eingeschliffene Verbindung von Leitungsaufgaben und höherem Dienst sei optimal. Wäre sie es wirklich, dann müßten die wissenschaftlichen Bibliotheken ja ganz vortrefflich dastehen und jenes progressive Management aufweisen, das man sich in Münster so sehr wünscht. Daß es mit dieser Progression nicht zum besten steht, hat indessen einen anderen Grund als das Ausbleiben eines modernen Verständnisses von Bibliotheksmanagement. Der nun fast dreißigjährige Siegeszug des Managementgedankens hat den Bibliotheken nämlich eine Fixierung auf verwaltungstechnische Binnenabläufe beschert, so daß nahezu sämtliche bibliothekarischen Profilierungen auf die Bibliothek als "Betrieb" gerichtet sind, wobei man gerne übersieht, daß die Verwaltung der Bibliothek nur eine abgeleitete Funktion ihrer wissenschaftlichen und Dienstleistungsaufgaben ist. Auf Grund dieser verkehrten bibliothekarischen Fixierung hat man aber lange schon keine Zeit mehr für die eigentlichen inhaltlichen Aufgaben, wie sie insbesondere in den Fachreferaten zutage treten: diese sind vielen wenig mehr als ein lästiger Appendix auf dem Weg nach oben, wo die Bibliothek als moderner "Betrieb" strahlend scheint. Da sich dieser leuchtende Schein aber als - Schein herausstellt, sollte man es einmal andersherum versuchen: mit einer Restitution der Inhalte.
2. Wissenschaft und bibliothekarische Legitimation
Für eine solche um wissenschaftliche Inhalte zentrierte bibliothekarische Arbeit hätten die Bibliothekare erstens "weder Auftrag noch Legitimation" und seien darin zweitens "weitgehend durch das akademische Personal der Institute und Lehrstühle substituierbar". Unsere Kollegen plädieren also für eine klare Aufgabentrennung zwischen Wissenschaft und Verwaltung und führen als Beleg an, daß in "konsequent einschichtigen Bibliothekssystemen" die Erwerbungskompetenz bei den Fachbereichen liege, "während dem Bibliothekar eindeutig und unbestritten die Kompetenz der Bibliotheksverwaltung zugesprochen wird." Dabei besteht der Trick darin, die Frage der Legitimation, der Kompetenz und des (juristischen) Umfeldes so aufzuaddieren, daß in der Summe der wissenschaftliche Bibliothekar als reiner Verwaltungsbeamter herauskommt. Wie falsch die Addition ist, zeigt sich, wenn man die einzelnen Rechnungsposten prüft.
a. Legitimation
Um behaupten zu können, die wissenschaftlichen Bibliothekare seien zu wissenschaftlicher Arbeit nicht legitimiert, muß man zunächst die gesamte Bibliotheksgeschichte von Kallimachos über die Mönche der mittelalterlichen Klöster, über Leibniz, Lessing, Dziatzko, Milkau bis hin zu Borges und dem immer noch anzutreffenden Bibliotheksdirektor, der seinen Professorentitel nicht nur ehrenhalber trägt, ignorieren. Ignorieren muß man auch, daß unser Beruf geradenwegs vom Professorenbibliothekar abstammt, der ein durchaus erfolgreicher Bibliothekarstyp war. Und ignorieren muß man schließlich, daß die ersten Generationen professioneller Bibliothekare in einem hohen Maß ein wissenschaftliches Verständnis ihrer Arbeit besaßen, dessen Dokument bis heute die Preußischen Instruktionen sind, denen man die Handschrift von Philologen ja deutlich ansieht. Dieses legitime Recht der Bibliothekare auf wissenschaftliche Arbeit hat man erst seit dem Ende der 60er Jahre zu bestreiten begonnen, als man von humanistisch gebildeten Bibliothekaren plötzlich nichts mehr hielt und auf Management und EDV setzte, um die Bibliotheken voran zu bringen. In der langen Geschichte der Bibliotheken ist das jedoch nicht mehr als ein Wimpernschlag.
b. Kompetenz
Daß die Bibliothekare in ihrer wissenschaftlichen Arbeit durch akademisches Personal ersetzbar seien, kann man nur schreiben, wenn man in Kategorien eines akademischen Reinheitsgebotes denkt. Danach dürften Wissenschaftler nichts als Wissenschaft betreiben, Chemiker nur in Labors stehen, Philologen nur lesen und Bibliothekare nur verwalten; und wenn die eine Partei in die Domäne der anderen eindringt, wird sie flugs "substituiert". Dabei übersieht man in Münster aus dem Abstand einer Zentralbibliothek wohl, daß wissenschaftliche Forschung in erheblichem Umfang aus Verwaltungsarbeiten besteht, vom Management des eigenen Lehrstuhles, des Instituts, der Fakultät bis hin zum Management einer Universität. Wenn aber in der Wissenschaft das Münsteraner Reinheitsgebot nicht gilt, warum sollte es dann in den Bibliotheken gelten?
Tatsächlich schreiben unsere Kollegen aus Münster, die die wissenschaftliche Arbeit der Bibliothekare zunächst für substituierbar halten, an späterer Stelle, daß die besten Ergebnisse für das Management einer Bibliothek von einer "Mischform" von Fachreferent und Manager zu erwarten seien. Genau in diesem Widerspruch liegt das Problem: Hält man die wissenschaftliche Arbeit der Bibliothekare für unverzichtbar, muß man für eine wirkliche Mischung von Wissenschaft und Verwaltungsaufgaben plädieren und darf sich nicht damit zufrieden geben, daß "für Fachreferatsaufgaben nicht mehr als dreißig Prozent der Dienstzeit verfügbar [sind] - Tendenz rückläufig"; meint man aber auf die wissenschaftlichen Aufgaben verzichten zu können, bleibt die Bibliothek als bloßer "Betrieb" übrig, der die "nachfragegerechte, zeiteffiziente und kostenoptimale Bereitstellung von Informationsressourcen für Lehrende und Studierende" allerdings auch ohne wissenschaftliche Bibliothekare leisten kann.
c. das (juristische) Umfeld
Daß der Bibliothekar an "konsequent einschichtigen Bibliothekssystemen" von der Erwerbung ausgeschlossen sei, ist eine westfälische Mär. Uns sind jedenfalls konsequent einschichtige Bibliothekssysteme bekannt, in denen die Fachreferenten kooperativ mit den Fakultäten oder gar völlig selbständig die Literaturauswahl treffen.
Aber merkwürdig bleibt diese Mär doch. Denn daß unsere Kollegen, die überall mit dem Impetus einer kreativen Flexibilisierung schreiben, ausgerechnet in diesem Kernbereich bibliothekarisch-wissenschaftlicher Kompetenz vor Bibliotheksordnungen kapitulieren, zeigt, daß man in Münster die Tiefendimension der Veränderungen, die auf das Bibliothekswesen zukommen werden, noch gar nicht erfaßt hat. Wenn diese Veränderungen nämlich die gängige Gleichung von höherem Dienst = Leitungsaufgaben auflösen werden, wie wir glauben, dann müßte die kreative Flexibilisierungsenergie in bibliothekarische Managementkonzeptionen münden, die sich vom alten Laufbahnrecht und alten Verwaltungsordnungen lösen und wirklich neue und zeitgemäße Verwaltungsstrukturen für unsere wissenschaftlichen Bibliotheken entwerfen.
Wer dagegen meint, mit dem neuesten Managementjargon das überkommene Laufbahngefüge legitimieren zu können, indem er von sich selbst dabei in den höchsten Tönen singt, betreibt wenig mehr als eine Besitzstandswahrung für den höheren Dienst, die mit Sicherheit nicht leisten wird, was sich ihre Adepten erhoffen.
3. Eingruppierung und Karriere
Liest man den Text unserer Kollegen vor diesem Hintergrund, wird schnell deutlich, daß die Kehrseite der Besitzstandswahrung die Angst ist. "Die Zurückweisung der Auffassung vom höheren Bibliotheksdienst als Verwaltungsberuf hat einen prägnanten besoldungspolitischen Hintergrund. Mit ihr soll die Bindung des Aufstiegs in Leitungsfunktionen an die Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben gekappt werden. [...] Vereinfacht gesagt: das bloße Fachreferat soll A 15 wert sein." Man muß diesen Passus langsam lesen, um seine Brisanz zu verstehen, eine Brisanz, die auf einer ganz anderen Ebene liegt, als unsere Kollegen meinen.
Erstens nämlich gilt in Münster offenbar nur der höhere Dienst als Verwaltungsberuf. Hier zeigt sich einmal mehr die am jetzigen Laufbahnrecht orientierte Legitimationsstrategie unserer Kollegen. Würden sie nämlich zugeben, daß auch der gehobene und mittlere Dienst einen Verwaltungsberuf ausübt, müßten sie den beiden Laufbahnen auch jene Leitungskompetenz zubilligen, die sie dem höheren Dienst als Verwaltungsberuf zuerkennen. Weil nun das Laufbahnrecht aber Leitungsaufgaben nur für den höheren Dienst kennt, lautet der westfälische Kurzschluß, daß dann der gehobene und mittlere Dienst eben kein Verwaltungsberuf seien.
Zweitens liegt für unsere Kollegen das eigentliche Problem darin, daß wir durch die "Kappung" von Verwaltungsaufgaben auch den Aufstieg in Leitungsfunktionen unmöglich machten. Tatsächlich haben wir uns niemals dafür ausgesprochen, den Aufstieg in Leitungsfunktionen von der Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben zu trennen. Wir haben lediglich bestritten, daß diese Koppelung ein Proprium des höheren Dienstes sei.
Drittens ist es in Münster wohl undenkbar, daß ein "bloßes" Fachreferat A 15 wert sein kann. Aber nachdem unsere Kollegen ja bereits zugegeben haben, daß eine "Mischform" zwischen Fachreferent und Manager das Richtige sei, müßten sie uns doch eigentlich zustimmen, daß dann auch die inhaltliche Arbeit in den Fachreferaten ernst genommen werden muß. Unserer Skizze, die solche Aufgaben zu umreißen versuchte, hält man nun aber entgegen, daß das alles bereits heute zu den Aufgaben in den Fachreferaten gehöre, von Mehrleistungen also nicht die Rede sein könne und deshalb eine Höhergruppierung nicht in Frage käme. Das ist wenig glaubhaft, nachdem man uns doch wenige Seiten zuvor versichert hat, daß der Anteil der Fachreferatsarbeit an den Aufgaben des höheren Dienstes kaum dreißig Prozent betrage und die Tendenz weiter rückläufig sei.
Nimmt man diese drei Punkte zusammen, dann zeigen sie, daß hier nach dem schlichten Programm argumentiert wird, wonach nicht sein kann, was nicht sein darf: es kann und darf nicht sein, daß andere als Angehörige des höheren Dienstes leiten; und es kann und darf nicht sein, daß der höhere Dienst etwas anderes macht als zu leiten. Denn nur so gibt es einen Aufstieg in Leitungsfunktionen - für den höheren Dienst. Löst man sich von diesem dem gängigen Laufbahnrecht verpflichteten tautologischen Argumentationsschema, dann sieht die bibliothekarische Welt auf einen Schlag ganz anders aus.
4. Jenseits des Laufbahnrechts
Beugt man sich einmal unvoreingenommen über das Laufbahnrecht, dann kann man die massive Fiktion nicht übersehen, die in der Koppelung von Schul- bzw. Hochschulabschlüssen und Kompetenzen liegt. Das damit in Gang gebrachte Berechtigungswesen führt nämlich zu dem legitimatorischen Bedürfnis, aus dem Innehaben einer Laufbahn auf mehr zu schließen als auf eine durch eine Prüfung erworbene formaljuristische Berechtigung: auf die eigene Kompetenz nämlich, die sich in dieser Laufbahn ausdrücken soll. Bevor man jedoch dieser legitimatorischen Neurose erliegt, wäre es sachgemäßer, die Neurose zusammen mit dem Laufbahnrecht als typische Produkte des 19. Jahrhundert hinter sich zu lassen. Erst dann kommen nämlich die Sachen, um die es geht, halbwegs unverstellt in den Blick. Um was also geht es?
Es geht darum, daß die Identität der wissenschaftlichen Bibliothek und der wissenschaftlichen Bibliothekare in der Wissenschaft liegt und daß deshalb für den wissenschaftlichen Bibliothekar die primäre Legitimation die Arbeit im Fachreferat ist. Das ist weder ein Plädoyer für ein "Fachspezialistentum" noch für einen Menschentyp, "der seine im zwanzigsten Lebensjahr getroffene Studienwahl als beruflich identitätsstiftend bis zur Ruhestandseintrittsschwelle begreift", wie unsere Kollegen schreiben. Denn weder wird man im Studium zum Fachspezialisten noch hat das Studium etwas mit der späteren Berufswahl zu tun (ein Germanist kann Lehrer werden, in die Industrie gehen oder Taxi fahren; ein Jurist kann Richter oder Anwalt oder Minister werden usw.). Freilich sind Karrieren, wo sie glücken, an Interessen gebunden und zumeist auf bestimmte Segmente bezogen. Zu fordern, daß der wissenschaftliche Bibliothekar ein dokumentiertes Interesse an Wissenschaft und Bibliotheken haben müsse, scheint uns daher selbstverständlich, nicht anders, wie man auch in der Wirtschaft ein dokumentiertes Interesse für Fahrzeuge mitbringen muß, wenn man in der Automobilbranche Karriere machen will. Der bibliothekarische Traum vom "Generalisten" ist daher nichts weiter als ein typischer Traum von Verwaltungsbeamten, die die Lektüre von Managementliteratur mit dem Haben von Kompetenzen verwechseln.
Kompetenzen zeigen sich in der Praxis. Und hier ist wenig mehr zu fordern, als daß diejenigen, die entsprechende Kompetenzen haben, in Leitungsaufgaben gelangen. Daß das Laufbahnrecht ein valides Kriterium zur Feststellung solcher Kompetenzen ist, darf man mit Recht bezweifeln. Dort jedenfalls, wo man ein wirkliches Management betreibt, verläßt man sich aus gutem Grund nicht nur auf schulische und andere Abschlüsse, wenn es um die Feststellung von Leitungskompetenzen geht. Wer sich also in den Bibliotheken flexibilisierend betätigen will, findet hier ein reiches Betätigungsfeld.
Die Erfahrungen jedenfalls, die man seit einigen Jahren mit bereits flexibilisierten ehemaligen Verwaltungszweigen (Bahn, Post, Telekom) machen kann, sprechen sehr für dieses Modell. Dafür spricht aber auch ein einfacher Realismus, der den höheren Bibliotheksdienst nicht in die Fiktion von Leitungsaufgaben hüllt, sondern ausspricht, daß immer nur eine Minderheit des höheren Dienstes in echten Leitungsaufgaben tätig war, während eine Fülle von Leitungsaufgaben nichts weiter als laufbahnrechtliche Induktionsschleifen darstellen, auf die man gut und gerne verzichten kann. Auf deutsch: der Druck von außen wird zu gegebener Zeit dafür sorgen, daß der "Betrieb" Bibliothek sein überflüssiges Leitungspersonal verliert und dank Outsourcing und Downsizing endlich jene "kostenoptimale Bereitstellung von Informationsressourcen" erreicht, von der unsere Kollegen sprechen. Ob sie dabei noch etwas mitzusprechen haben werden, ist eine andere Frage.
Keine Frage aber ist, daß die Hochschulbibliothek als wissenschaftliche Einrichtung sich gerade auch in der Konkurrenz zu neuen Informationsanbietern ganz anders positionieren müssen wird, als man in Münster und anderswo glaubt. Bei dieser Positionierung kommt den wissenschaftlichen Bibliothekaren eine hervorragende Rolle zu. Diese Rolle zu finden und genaugenommen wiederzufinden, dazu wollten wir einen Beitrag leisten.
