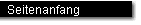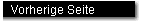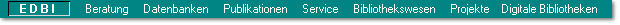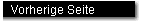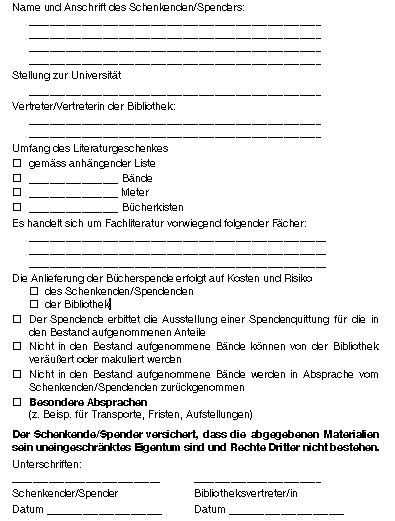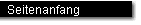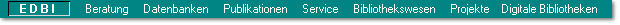


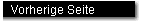
BIBLIOTHEKSDIENST Heft 6, 2000
Empfehlungen zur Behandlung von Geschenk- und Tauschliteratur
Werke, die als Geschenk oder auf dem Tauschwege in den Bestand der Bibliotheken gelangen, stellen derzeit im Durchschnitt ein Drittel des Gesamtzuganges dar. Der Anteil des Tausches am Erwerbungsvolumen lag in den letzten drei Jahren in Universitätsbibliotheken bei knapp 10%.1
Die folgenden Empfehlungen der Erwerbungskommission zur Behandlung von Tausch- und Geschenksendungen sind anzuwenden im Rahmen der lokalen Erwerbungs- und Beschaffungsprofile. Sie sind zu sehen vor dem Hintergrund der hohen Kosten für die Erweiterung von Magazin- und Stellflächen und dem Zwang zur Verlagerung des Personaleinsatzes von verwaltungsinternen in benutzernahe Bereiche. Die Empfehlungen gelten für alle Publikationsformen (Einzelmonographien, Periodika usw.), aber auch und insbesondere für alle frei verfügbaren elektronischen Dokumente, deren Bereitstellung analog zur Verwaltung gedruckter Publikationen eine originäre Bibliotheksaufgabe ist.
Bereits 1986 hat der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen zum Magazinbedarf wissenschaftlicher Bibliotheken2 zur Frage der Kriterien bei der Behandlung von Tausch- und Geschenkzugängen Stellung genommen und sich für deren Reduzierung ausgesprochen. In der Folge hat die KMK am 23./ 24.6.1988 Grundsätze für die Veröffentlichung von Dissertationen3 beschlossen, mit der die Anzahl der an die Hochschulbibliothek abzuliefernden Dissertationsexemplare deutlich verringert wurde. Durch Einrichtung regionaler Sammelschwerpunktbibliotheken4 auf Länderebene wurde gleichzeitig beabsichtigt, dass trotz Reduktion des Tauschverkehrs von einer Dissertation weiterhin in jeder Bibliotheksregion ein Exemplar im Leihverkehr zur Verfügung stehen sollte.
In Nordrhein-Westfalen wurden mit Erlass5 vom 23.1.1990 Richtlinien über die Aussonderung von Bibliotheksgut, Behandlung von Buchgeschenken und Durchführung des Schriftentausches durch die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben. Im weiteren Verlauf sind in einigen Ländern Richtlinien zur Behandlung von Geschenk- und Tauschliteratur erlassen worden.6
Die Empfehlungen der Kommission für Erwerbung und Bestandsentwicklung stehen im Kontext dieser bisherigen Überlegungen unter Einbeziehung der neuen Entwicklungen zur Publikation, Distribution und Präsentation wissenschaftlicher Dokumente und Informationen in elektronischer Form.
1. Geschenke
- Werke, die unentgeltlich und ohne Einsatz von für den Erwerb wissenschaftlichen Schrifttums bestimmter Haushaltsmittel in die Bibliothek gelangen, sind akzessorisch und erwerbungsstatistisch als Geschenkzugang zu behandeln. Darunter fällt auch das hochschuleigene Schrifttum einschließlich der am eigenen Hochschulort veröffentlichten Dissertationen. Geschenke können erbeten oder unverlangt sein.
- Das Erbitten ist Ausdruck bewussten Bestandsaufbaus und erwerbungspolitisch sinnvoll vor allem bei außerhalb des Buchhandels erschienener Grauer Literatur von Verbänden, Parteien, Behörden, Firmen und Korporationen. Im Zweifelsfall erbittet die Bibliothek "als Geschenk oder gegen Rechnung". Erbetene Geschenke entlasten den Erwerbungsetat.
- Für unverlangt eingehende oder angebotene Geschenke gilt der Grundsatz, dass in den Bibliotheksbestand nur Aufnahme zu finden hat, was dem Sammelprofil und der Versorgungsfunktion der Bibliothek entsprechend auch gekauft werden würde. Es sind unter Berücksichtigung von Verwaltungsaufwand und Stellplatzbedarf strengste Maßstäbe anzulegen.
- Diese strengen Auswahlkriterien gelten gleichermaßen bei unverlangt angebotenen Nachlässen, Sammlungen und Bibliotheksauflösungen von Institutionen, Firmen und Privatpersonen.
- Die Bibliothek hat grundsätzlich Interesse an einer für Bibliotheksfragen aufgeschlossenen Öffentlichkeit. Bei der Ablehnung von Geschenken, die in wohlmeinender Absicht und in Unkenntnis der Bibliotheksziele erfolgen, bisweilen auch ihre Ursache in Autorenehrgeiz oder Platzmangel des Abgebenden haben, ist deshalb abwägende Vorsicht und diplomatisches Geschick erforderlich.
- Mit einer Schenkung verbundene Auflagen und Verpflichtungen (z. B. geschlossene Aufstellung, Übernahme der Transportkosten) sind sorgfältig zu prüfen und nach Möglichkeit zu vermeiden. Auf eine in das Ermessen der Bibliothek stehende Weiterverwertung durch Abgabe, vor allem aber die Möglichkeit einer Veräußerung zugunsten des Erwerbungsetats oder auch der Makulierung sollte ausdrücklich hingewiesen werden.
- Mit unerbetenen Geschenken kann die Bibliothek im Prinzip nach Belieben verfahren. Eine Rücksendeverpflichtung besteht nicht, eine angemessene Aufbewahrungsfrist nur bei mit Auflagen verbundenen, unverlangten Ansichtssendungen bzw. solchen mit erkennbarer Verkaufsabsicht. Nur im Ausnahmefall sollte der Schenkende über die Nichtaufnahme in den Bestand und über die Möglichkeit der Rückforderung auf eigene Kosten informiert werden.7
- Ein Dankschreiben für erbetene und/oder angenommene Geschenke gegebenenfalls auch nur eine kurze individuelle Rückmeldung kann gute Werbung und lohnende Öffentlichkeitsarbeit sein.
- Für angenommene Geschenke kann auf Wunsch durch die zuständige Dienststelle (z. B. die Hochschulverwaltung) eine den Formerfordernissen der Finanzämter genügende Spendenbescheinigung ausgestellt werden, eventuell vorhandene örtliche Richtlinien sind zu beachten. Bei der Wertansetzung ist der Markt- und/oder Antiquariatswert zugrunde zu legen. Die Ermittlung des Wertes sollte ohne unangemessenen Aufwand erfolgen. In Fällen, in denen es der annehmenden Bibliothek angeraten scheint, sollte ein Abgabe-/Übernahmeerklärung (vgl. anschließende Muster-Vereinbarung) unterzeichnet werden. Für die Entwidmung vorhandener Vorbesitzvermerke sollte der Schenkende in geeigneter Form Sorge tragen.
- Bei der Abgabe von Geschenken an andere Bibliothekseinrichtungen empfiehlt es sich, die im Internet aufliegenden Geschenk- und Tauschprofile zu konsultieren8 und die Liste Dubletten-L9 in Anspruch zu nehmen.
2. Tausch
- Die wechselseitige Zusendung von Publikationen in Form des Schriftentausches ist für den Bestandsaufbau von nicht geringer Bedeutung. Die Beschaffung von nicht im Buchhandel erschienener Literatur aus dem Hochschulbereich ist zuverlässig vielfach nur über etablierte Tauschbeziehungen möglich. In die Kategorie Tausch fallen auch alle von Tauschpartnern unverlangt und als Geschenk überlassenen Einzelveröffentlichungen (Kataloge, Broschüren, Dubletten, Selbstdarstellungen u.a.).
- Für die Aufnahme und die Unterhaltung von Tauschbeziehungen gilt wie für Geschenke der Grundsatz, dass in den eigenen Bestand nur eingearbeitet werden sollte, was inhaltlich und formal dem Sammelprofil und dem Versorgungsauftrag der Bibliothek entspricht. Dabei sind strengste Maßstäbe anzulegen. In größeren Abständen sind die Tauschbeziehungen auf ihre inhaltliche Ausgestaltung hin zu überprüfen.
- Für den allgemeinen Schriftentausch mit institutseigenen Publikationen und den Dublettentausch ist der regelmäßige und unberechnete Tausch die übliche Geschäftsform. Verrechnungstausch ist aus Gründen der Tauschökonomie nur im internationalen Verkehr für den Novitätentausch ("Kauf-Tausch") mit devisenschwachen Partnern angezeigt.
- In Zukunft sollte im Rahmen des allgemeinen Schriftentausches auf die unverlangte Zusendung von Einzelstücken verzichtet werden. Über diese Titel sollte vielmehr in Form von fachlich strukturierten Angebotslisten per Brief, E-Mail und/oder über Dubletten-L informiert werden und eine Zusendung erst auf Abruf und Nachfrage erfolgen.
- Der Dissertationentausch hat in Bibliotheken eine lange Tradition. Druckzwang, Ablieferungsverpflichtung und Verbreitungsgebot stehen im Zusammenhang mit der Forderung nach öffentlicher Überprüfbarkeit der Promotionsleistung. Ein flächendeckender Tauschversand für Dissertationen erfolgt nicht mehr. Für die im Dissertationentausch abzugebende Hochschulschriften empfiehlt es sich, vorab in fachlich strukturierten Angebotslisten per E-Mail, Brief oder im WWW zu informieren und Verteilung und Versand der Dissertationen erst auf Abruf und Nachfrage vorzunehmen. Sofern nicht inhaltlich fest definierte Tauschabsprachen (z.B. auf Sammelschwerpunktebene) vorliegen, sollte auch beim Dissertationentausch eine unaufgeforderte Zusendung von Exemplaren unterbleiben.
- Die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz vom 30.10.199710 zur Veröffentlichung von Dissertationen in elektronischer Form und damit verbunden zu einer entsprechenden Novellierung der Promotionsordnungen, sollten von Bibliotheksseite nachdrücklich unterstützt und ihre Umsetzung von den Hochschulen eingefordert werden. Sie sind ein Beitrag zur Reduzierung des mit dem Dissertationentausch verbundenen Verwaltungsaufwandes und Stellplatzbedarfs. Die Internet-Adresse von auf lokalen Dokumentenservern aufliegenden elektronischen Dissertationen sollte den Tauschpartnern, um ein Herunterladen auf den eigenen Rechner zu ermöglichen, mitgeteilt werden. Wie bei Printpublikationen ist vor dem Speichern von Fremddissertationen im lokalen Netz eine sich am Sammelprofil und Sammelauftrag der Bibliothek orientierende Auswahlentscheidung erforderlich.
- Zu Tauschzwecken sind Dissertationen der eigenen Hochschule entsprechend den KMK-Empfehlungen in angemessener kleiner Stückzahl vier Jahre lang vorzuhalten.
Muster
Übergabe- / Annahmeerklärung
für eine Literaturspende / -geschenk
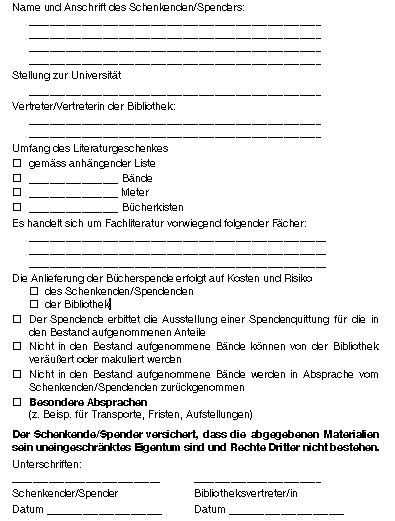
1 Eine Auszählung der Tabelle 06 der Deutschen Bibliotheksstatistik der Jahre 1996, 1997 und 1998 für den Sektor der Universitätsbibliotheken ergab ein relativ konstantes Tauschvolumen von im Durchschnitt 9,84% des Kaufzugangs. Bei den Geschenkzugängen liegt der Durchschnittswert der letzten drei Jahre bei 33,53%.
2 Wissenschaftsrat. Empfehlungen zum Magazinbedarf wissenschaftlicher Bibliotheken. - Köln 1986.
3 Vgl. Bibliotheksdienst 22 (1988), S. 887 f.
4 Deutscher Bibliotheksverband - Sektion 4: Regionale Sammelschwerpunkte für bundesdeutsche Dissertationen (Beschluss vom 22.3.1990), in: Bibliotheksdienst 24 (1990), S. 939 ff.
5 Erlass des Ministers für Wissenschaft und Forschung des Landes NRW vom 23.1.1990. URL: http://www.hbz-nrw.de/hbz/erlass.html
6 Für Baden-Württemberg: Richtlinien für die Aussonderung von Bibliotheksgut sowie Auswahlkriterien für den Bestandszuwachs durch den Schriftentausch (Aussonderungsrichtlinien) vom 19. Mai 1998
Für Bayern: Richtlinien für die Aussonderung, Archivierung sowie Bestandserhaltung von Bibliotheksgut in den Bayerischen Staatlichen Bibliotheken vom 21. Juli 1998
Für Brandenburg: Richtlinien über die Aussonderung von Bibliotheksgut, Behandlung von Buchgeschenken und Durchführung des Schriftentausches durch die Hochschulen des Landes Brandenburg vom 30. Aug. 1994
Für Mecklenburg-Vorpommern : Richtlinien über die Aussonderung von Bibliotheksgut, Behandlung von Buchgeschenken und Durchführung des Schriftentausches durch die Hochschulbibliotheken des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Erlass vom 7. Juli 1993
Für Thüringen: Richtlinie über die Abgabe von Bibliotheksgut an die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena und andere Thüringer Bibliotheken vom 31. Jan. 1996
7 BGB 516 (2) bestimmt für das Wirksamwerden eines Geschenkvertrages "angemessene" Fristen. In der Literatur werden Fristen von einem Jahr bis zu maximal drei Jahren für sehr wertvolle Bücher als "angemessen" empfohlen.
Vgl.: Rechtskommission des DBI. Frühjahrssitzung in Augsburg, in: Bibliotheksdienst 26 (1992), S. 891. Dirnaicher, Udo: Rechtsfragen im Zusammenhang mit der unaufgeforderten Zusendung von Büchern an Bibliotheken, in: Die neue Bücherei 1995, S. 1-4, hier S. 3.
8 vgl. http://homepages.uni-tuebingen.de/juergen.plieninger/bibdubl.htm
9 vgl. dubletten@dbi-berlin.de. Die Kommission geht davon aus, dass diese Liste nach Auflösung des DBI auf den Server bei einem der deutschen Bibliotheksverbünde übernommen wird.
10 Kultusministerkonferenz: Grundsätze für die Veröffentlichung von Dissertationen, in: Bibliotheksdienst 32 (1998), S. 750 f.
Stand: 31.05.2000