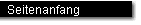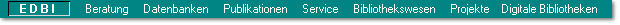


1. Initiative der Staatsregierung:
Bayern Online
Bürgernetzvereine sind vermutlich in anderen Bundesländern weitgehend unbekannt. Deshalb werde ich zunächst etwas weiter ausholen und die Hintergründe schildern.
Am 21. Juli 1994 erklärte der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber in seiner Regierungserklärung, daß die Staatsregierung "konkrete Projekte auf den Weg bringen würde, um den breiten Einsatz modernster Kommunikationstechniken auf unterschiedlichsten Gebieten zu beschleunigen." (Zitat aus "Bayern Online", Heft der Bayerischen Staatsregierung, S. 3)
Dafür sollten zunächst 100 Millionen DM eingesetzt werden. Der Regierungspräsident hatte erkannt, daß Bayern im internationalen Wettbewerb unweigerlich zurückfallen muß, wenn auf diesem Gebiet nichts unternommen wird. Allerdings galt es zunächst, dreierlei Hemmnisse zu überwinden:
Um das Wissen um die Einsatzmöglichkeiten der neuen Kommunikationstechnologien zu vermehren, startete die Staatsregierung eine breit angelegte Informationskampagne.
Pilotprojekte wurden gefördert, Arbeitskreise zu unterschiedlichen Themen gebildet, z.B. auf dem Gebiet der Medizin oder "Telearbeit und virtuelle Unternehmen".
Der wesentlichste Faktor blieben jedoch die hohen Kosten, die bei Privatpersonen oder Unternehmen entstehen dies verhindert auch ein interessantes Angebot. Dem begegnete die Staatsregierung mit der Gründung eines neuen Hochgeschwindigkeitnetzes, dem Bayernnetz. Als Grundlage dieses Netzes wurden zunächst alle Universitäten und Fachhochschulen miteinander verbunden. Dies stellte sozusagen ein Hochgeschwindigkeit-Backbone dar, auf dem alle überregionalen Sprach- und Datentransfers gebündelt werden sollten. Zunächst sollte das vorhandene Telekommunikationsnetz der Telekom für dieses Hochgeschwindigkeitsnetz angemietet werden. Später sollte ein eigenes, leistungsstarkes Netz entstehen mit eigenem Betreiber. Regionale Einwählknoten, die per Standleitung an einen Hochschulrechner angebunden werden, wurden geplant. Hier sollten sich Behördennetze und Stadtnetze anschließen. Bei den Stadtnetzen wurde zunächst an München und Nürnberg gedacht. Ein weiterer Einwahlknoten, der Zugang für private Teilnehmer über Telefonleitung ermöglichen sollte, sollte angeschlossen werden. Durchschnittsbürgern sollte so ermöglicht werden, zu lokalen Telefonkosten untereinander zu kommunizieren und in das Internet zu gelangen. Dies nennt man ein Bürgernetz.
Der wesentlichste Faktor ist, daß die Nutzung des Servers und damit auch der Zugang zum Internet zunächst kostenlos von der Staatsregierung dem Bürgernetz zur Verfügung gestellt wird.
Der Ausdruck "für jeden" ist dabei so zu verstehen, daß jedermann in allen Rollen, die er in der Gesellschaft inne hat, durch das Bürgernetz unterstützt wird. Der Schreinermeister z.B. soll also alle für sein Fach wichtigen Informationen über Holzsorten, Lacke, neue Verarbeitungsverfahren von seiner Innung beziehen können. Wenn dieser Schreinermeister überdies einen kleinen Betrieb führt, dann benötigt er zusätzliche Angaben über die Sozialversicherungsbeiträge, die er abzuführen hat, den rechtlichen Rahmen, den er beachten muß usw. Diese Informationen soll er von den jeweiligen Versicherungsträgern und Behörden abrufen können. Natürlich ist er auch daran interessiert, seine Waren zu verkaufen. Das Bürgernetz bietet ihm ein "elektronisches Schaufenster", in dem er seine Möbel darstellen kann.
Ist unser Schreinermeister verheiratet und hat zwei Kinder, die Schule und Kindergarten besuchen, dann muß er die Möglichkeit haben, mit Lehrern und Kindergärtnerinnen in Verbindung treten zu können – wann immer es seine Zeit erlaubt. Er muß Auskünfte über Schullaufbahnen erhalten können, etc.
Es ist Aufgabe des Bürgernetzes, den Schreinermeister und all die anderen Bürger, die den Computer allenthalben als notwendiges Übel ansehen, zu befähigen, aktiv an einem Datennetz zu partizipieren. Dazu bietet es Einführungskurse und Weiterbildungsveranstaltungen an, in denen jeder lernen kann, die Angebote von Datennetzen zu nutzen und selbst Informationen einzustellen.
Nun verfügt aber nicht jeder über die notwendige technische Ausrüstung, um am Bürgernetz teilzunehmen. Die Betreiber des Netzes sind daher gehalten, möglichst viele öffentliche Zugangsmöglichkeiten an zentralen Punkten, etwa dem Eingangsbereich einer Bank, einzurichten. Außerdem versuchen die Bürgernetzknoten, die in der Bevölkerung vorhandene Technologie zu nutzen. Es ist z.B. angedacht, Fernseher, die über Fernsehkabel gespeist werden, über sogenannte "Set-Top-Boxen" zu interaktiven Geräten zu machen und so die kostengünstige Teilnahme am Bürgernetz zu ermöglichen.
Der bloße Zugang zum Datennetz jedoch verspricht noch keine wirkliche Nutzung. Vielmehr müssen im Netz auch nutzbare Informationen zu finden sein. Hierzu wird das Bürgernetz alle gewachsenen Informationsquellen (im Falle des o.g. Schreiners also z.B. die Innung, die Handwerkskammer, den Versicherungsträger etc.) um Bereitstellung der für das jeweilige Klientel interessanten Inhalte bitten. Ein besonderes Anliegen des Bürgernetzes ist es dabei, daß alle Gruppen, die gesellschaftlich wichtige, wirtschaftlich aber nicht attraktive Informationen anzubieten haben, ebenfalls in die Lage versetzt werden, ihre Tätigkeit durch Nutzung des Datennetzes zu unterstützen. Hier ist insbesondere an den sozialen Bereich gedacht, aber auch an Glaubensgemeinschaften, kleine Vereine und Interessensgruppen,; Kleinst- und Nebenerwerbs-Betriebe sollen ebenso eine Chance erhalten. Das Bürgernetz ist also offen für jeden, ohne Rücksicht auf Name, Rang, Herkunft, Religionszugehörigkeit und ähnliche Kriterien. "Rosinenpicken" wird es nicht geben!
Dem Bürgernetz ist natürlich bewußt, daß die Gewinnung von Wissen und Information oft mit hohem (insbesondere finanziellem) Aufwand verbunden ist. Institutionen, die dieses i.d.R. hochwertige und innovative Wissen bereitstellen, wird angeboten, sich an die Infrastruktur des Bürgernetzes anzuschließen und damit den Zugang zu diesen Daten für jedermann zu ermöglichen. Das bedeutet nicht, daß diese Informationen in jedem Fall kostenfrei verfügbar sein müssen.
Wer auf einem Server im Bürgernetz Informationen hinterlegt, kann Hinweise darauf in einem zentralen, über alle Themengebiete reichenden Index einbringen. Aus diesem Index ist ersichtlich, wo die Informationen gelagert sind, wie darauf zugegriffen werden kann, welcher Urheberrechtsschutz dafür gilt. Dieser Index ist öffentlich zugänglich. Durch dieses "offene System" soll Dritten die Möglichkeit gegeben werden, Applikationen für das Datennetz zu entwickeln, die erst eine sinnvolle und praxisnahe Nutzung der Informationen ermöglichen. Steigt unser Handwerksmeister also über ein fachspezifisches Programm in das Datennetz ein, so erhält er eine Oberfläche, die seiner Denkweise als Handwerker entspricht. Daß die Informationen, die er abruft, im Hintergrund von mehreren Rechnern zusammengestellt werden, darf er höchstens an den unterschiedlichen Antwortzeiten des Systems merken.
Besonderen Wert legt das Bürgernetz auf die Möglichkeit, über das System zu kommunizieren. In den Schulungen wird den Bürgern nahegelegt, zu jeder Informationsseite auch einen Hinweis zuzufügen, aus dem ersichtlich ist, wie der Informationsanbieter für Rückfragen zu erreichen ist. Moderne Benutzeroberflächen (etwa die Browser für das World Wide Web) bieten hier elegante Möglichkeiten, auf Knopfdruck z.B. elektronische Post zu versenden.
Im Sinne einer erweiterten Basisdemokratie bittet das Bürgernetz auch jeden Informationsanbieter, sich in sogenannten "Newsgroups" der öffentlichen Diskussion zu stellen. Es ist eine für unsere Kultur ungewöhnliche Verhaltensweise, eine Information über ein öffentliches Medium zu bekommen und darauf zu antworten. Daher wird es eine wichtige Aufgabe der Bürgernetze sein, die Menschen an den verantwortungsbewußten Umgang mit den neuen Möglichkeiten ("Netiquette") heranzuführen.
Daneben werden über das Bürgernetz selbstverständlich die Möglichkeiten des "Chat", also der Nutzung des Computers als Sschreibtelefon, und des "IRC", das ist eine Konferenzschaltung von Schreibtelefonen, verfügbar sein. Und weil das Bürgernetz Bestandteil des Internet ist, wird die Kommunikation weltweit möglich sein.
Die Aufgaben des Bürgernetzes sind vielfältig, wie eben beschrieben. Ein Teil davon ist im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung gemeinnützig. Dieser Teil ist organisatorisch in der Regel aus dem Betrieb ausgegliedert und wird durch Vereine, den sogenannten Fördervereinen des Bürgernetzes, wahrgenommen.
In Bayern bestehen derzeit (Stand Oktober 1996) 55 Fördervereine. Daneben gibt es ca. 30 weitere Initiativen , aus denen heraus in Kürze Fördervereine gegründet werden. Alle Bürgernetzknoten stehen in engem Kontakt zueinander, denn ein koordinierter Aufbau der Inhalte ist zur Erreichung der Ziele unerläßlich.
Durch die Inbetriebnahme des Bürgernetzes soll insbesondere dem Gedanken des Art. 5 GG, also des freien Zugangs zu öffentlichen Informationsquellen, Rechnung getragen werden. Das Verhältnis des Bürgernetzes zu privaten Anbietern ist also dahingehend zu verstehen, daß das Bürgernetz Basiswissen bereitstellt, das dann durch private Institutionen ergänzt wird.
Weiden ist eine Stadt mit 43.000 Einwohnern. In unmittelbarer Nähe liegt die Stadt Neustadt, die vielleicht 4.000 Einwohner hat. Zwar befindet sich dort das Landratsamt, trotzdem ist sie im Vergleich zu der Stadt Weiden relativ unbedeutend. In dem Landratsamt sitzt jedoch ein seit 96 gewählter Landrat, Simon Wittmann, der von den neuen technischen Möglichkeiten begeistert ist. Ihm gelang es auch, den Oberbürgermeister der Stadt Weiden zu überzeugen, daß ein Bürgernetzverein eine sinnvolle Einrichtung ist. Unser Oberbürgermeister ist und war stets allem Neuen gegenüber sehr aufgeschlossen. Auch die Bibliothek ist, so wie sie heute dasteht ohne seine Unterstützung nicht zu denken, aber für die modernen Kommunikationsmittel kann er sich nicht begeistern. So wurde dieser Bürgernetzverein zunächst nur in Neustadt aktiv, d.h. die Homepage der Stadt Weiden ist immer noch im Aufbau und wird zur Zeit von der Arbeitsgruppe des Bürgernetzvereins gestaltet.
Die Power, die von diesem Verein ausgeht, geht ebenfalls von dem Vorsitzenden, seinen Mitarbeitern und den inzwischen entstandenen Arbeitsgruppen aus. Der Bürgernetzverein Neustadt-Weiden hatte seine erste Informationsveranstaltung am 10.07.96 in der Fachhochschule Weiden, gegründet wurde er am 17.10.96 in Neustadt. Es dauerte jedoch noch ein Jahr, bis zum 18.06.97, bis der erste offizielle Zugang ins Bürgernetz durch den Landrat Simon Wittmann und den Oberbürgermeister Hans Schröpf gestartet werden konnte. Dann entwickelte er sich jedoch sehr schnell und zählte nach knapp einem Jahr bereits 1000 Mitglieder.
Die Frage ist, wie kann man andere, breite Bevölkerungsschichten erreichen?
Hierfür sind in besonderer Weise – meiner Ansicht nach – die Öffentlichen Bibliotheken geeignet, die leider in dem Plan der Staatsregierung kaum Erwähnung gefunden haben.
Zwar besteht seit langem ein Projekt "Schulen ans Netz", doch nach wie vor werden die Möglichkeiten der Öffentlichen Bibliotheken übersehen. Das sagt alles über den Stellenwert, den die öffentlichen Bibliotheken bei der Politik und zum Teil auch in der Gesellschaft haben.
Wir selber wissen, daß die Ausleihen der öffentlichen Bibliotheken Jahr für Jahr steigen, daß die Akzeptanz bei der Bevölkerung wächst, um so wichtiger ist es für uns, mit der Zeit zu gehen, die Möglichkeiten der modernen Kommunikationstechnologien in unsere Häuser zu integrieren. Das kann keine Bibliothek alleine Leisten, das kann sie nur im Verbund mit den Beratungsstellen und mit der Generaldirektion. Ohne diese Unterstützung würde der Staat die öffentlichen Bibliotheken wahrscheinlich einfach vergessen. Aber wie Herr Dahm sicherlich bestätigen kann, reicht diese Unterstützung alleine auch nicht aus.
Aber wie Herr Dahm sicherlich bestätigen kann, reicht diese Unterstützung alleine nicht aus. Vor Ort muß inzwischen von den einzelnen Bibliotheken in ihrer Verwaltung Überzeugungsarbeit geleistet worden sein, um die Pläne der Generaldirektion zu verwirklichen zu können, da die Hälfte der Kosten von den einzelnen Kommunen getragen werden muß.
Wie diese Vorarbeit aussehen kann, will ich anhand der Regionalbibliothek Weiden schildern.
Am 21. Oktober 1994 wurde die Bibliothek im Waldsassener Kasten, einem barocken historischen Gebäude unserer Stadt, eröffnet.
Für die technische Planung war die Organisationsabteilung der Stadt Weiden verantwortlich, die damals von Herrn Legat geleitet wurde. Dank seiner Aufgeschlossenheit den neuen Kommunikationstechniken gegenüber und unserem guten, seit Jahren gepflegten kollegialen Verhältnis, gelang es uns, mit seiner Unterstützung, die Infothek mit Computernutzung für unsere Leser zu verwirklichen.
Auch unser Kontakt zu der Deutschen Telekom, Geschäftsstelle Weiden, aufgebaut durch unser Projekt "Bayerisch-Böhmische Kulturtage", kam uns sehr zustatten. Die Telekom installierte auf unseren Wunsch in der Infothek ein Datex-J-Gerät, Vorläufer von T-Online, das zunächst auf großes Interesse bei den Benutzern stieß und unser Angebot vergrößerte.
Ein Jahr später bekam Weiden eine Fachhochschule. Noch in seinem ersten provisorischen Büro führte ich ein Gespräch mit dem Präsidenten der Fachhochschule, Professor Behr, über eine Standleitung unserer Bibliothek an den Fachhochschule-Server. Prof. Behr war außerordentlich aufgeschlossen, ebenso der technische Leiter der Fachhochschule, Herr Dotzler. Dem Anschluß der Bibliothek an den Server schien nichts entgegenzustehen. Die Fachhochschule war schnell gebaut und eingeweiht, aber das Einrichten des Servers zog sich monatelang hin.
Für uns jedoch schien Eile geboten, endlich an das Internet zu kommen, denn eine unserer Hauptserviceleistungen der Bibliothek ist die Fernleihe. Diese sollte in absehbarer Zeit nur noch über das Internet möglich sein. Der Weg, mit Hilfe unserer eigenen Stadtverwaltung, dieses Ziel zu erreichen, blieb uns verschlossen. Zwar hieß es jahrelang, die Stadt Weiden sucht einen Provider, wir erstellten Unterlagen, wie wir uns unsere Homepage vorstellen könnten, aber nichts geschah. Wir suchten also weiter nach einem kostengünstigen Weg ins Internet.
Wieder kamen uns unsere guten Beziehungen zur Telekom zu Hilfe. Der Leiter der Geschäftsstelle Weiden ließ die Leitung des Datex-J-Gerätes für ein dreiviertel Jahr freischalten. Daran legten wir unseren Computer mit Internetanschluß. Freischaltung bedeutet, wir zahlten in dieser Zeit keine Telefongebühren. Dieses dreiviertel Jahr nutzten wir zur Einarbeitung der Kolleginnen der Infothek.
Wir begannen mit der Bearbeitung der Fernleihscheine und den ersten Auskünften für die Leser mit Hilfe des neuen Mediums. Wir hängten die Geschichte nicht an die große Glocke, da wir nicht sicher waren, wie hoch die finanzielle Belastung werden würde bei einer normalen Nutzung des Internets. Da unser Oberbürgermeister nach wir vor dem Internet gegenüber sehr skeptisch war, wußten wir nicht, wie wir der Stadtverwaltung hohe Telefonkosten vermitteln könnten.
Um einen weiteren, vermutlich günstigen Zugang, für die Bibliothek ans Netz zu erschließen, wurden wir Mitglied im Bürgernetzverein. Ich ließ mich am 17.10.96 in die Vorstandschaft wählen. Von der Gründungsveranstaltung bis zur Installation der Hard- und Software verging allerdings noch einmal, wie ich vorhin schon sagte, ein ganzes Jahr, zumindest bis alle Mitglieder, auch wir, angeschlossen waren. Durch den Anschluß an das Bürgernetz hofften wir, daß die Kosten bis auf Weiteres überschaubar würden.
Tatsächlich hatten sich in der Zeit nach dem Wegfall der Freischaltung unsere Telefonkosten in astronomische Höhen geschraubt. Diese pendelten sich aufgrund der Zugehörigkeit zum Bürgernetzverein inzwischen jedoch auf monatliche Kosten von ca. 125 bis 150 DM plus einer Jahresgebühr von 100 DM ein.
Ein weiterer Vorteil, den uns das Bürgernetzverein brachte, waren der Arbeitskreis "Technik" und der Arbeitskreis "Seitengestaltung". Mit dem Know-How dieser jungen engagierten Kollegen wurde unsere Homepage erstellt, die wir selber inzwischen mit dem Programm "Frontpage 98" pflegen.
Aber auch die Bibliothek paßt genau in das Konzept des Bürgernetzvereins. Das, was er sucht, sind öffentliche Zugangsstellen. Dafür ist die Bibliothek ganz besonders mit ihrem interessanten Kundenkreis geeignet. Dieser Kundenkreis deckt sich fast vollständig mit dem Kreis der Interessenten an so einem Netz. Die größte Zahl der Leser rekrutiert sich nämlich aus den 20- bis 40jährigen. Dazu kommen die Kinder und Jugendlichen, die in der Infothek ebenfalls die Möglichkeit haben, das Internet kennenzulernen.
Da unsere Infothek ab 12 Uhr durchgehend besetzt ist, stehen auch jederzeit für Anfragen und Einführungen Kolleginnen zur Verfügung. Auch das ist ein Plus für das Bürgernetz. So können wir neue Interessenten werben und mit den Aufnahmeanträgen, die bei uns liegen, gleich zu Mitgliedern machen. Anträge gehen wie warme Semmeln. 20 Anträge wurden in einem Monat abgeholt.
Auch gemeinsame Veranstaltungen bieten sich an. Jahr für Jahr feiert die Bibliothek im Herbst ein großes Wein-Lese-Fest. Auf mehreren Etage stellen sich die verschiedenen Gruppen der Bibliothek dar. Das Kinderhaus mit eigenem Programm, die Infothek und vieles mehr. In die Infothek laden wir regelmäßig außenstehende Computerhersteller ein, die ihre Angebote dort präsentieren können.
1997 luden wir den Bürgernetzverein ein, sich bei uns darzustellen. Das wurde ein großer Erfolg. Zum einen für uns, da im Bürgernetz das gesamte Festprogramm vorgestellt wurde, zum anderen für das Bürgernetz, weil sie vielen neuen Interessenten Einblicke in die Möglichkeit dieses Netzes vor Ort geben konnten. Mit Hilfe einer digitalen Kamera präsentierten sie sogar live das Geschehen vor Ort im Internet. Folge: Der Bürgernetzverein kaufte für diesen und ähnliche Anlässe so eine Kamera.
Unsere aktuellste Zusammenarbeit mit dem Bürgernetz betrifft einen WWW-OPAC. Wie ich anfangs dargestellt habe, wollten wir uns schon lange mit einer Standleitung an den FH-Server anschließen. Trotz der positiven Einstellung der Fachhochschule gibt es bürokratische Hindernisse, bei denen niemand weiß, wie sie zu umgehen sind. Das Projekt schien gescheitert zu sein. Grundsätzlich ist es jedoch auch nicht möglich, in den Teil des Bügernetz-Servers eine weitere Standleitung anzuschließen.
Da ich davon überzeugt bin, daß ein WWW-OPAC unserer Bibliothek nicht nur für die Bürger der Stadt Weiden sondern auch für die Region ein großer Gewinn sein könnte, stellte ich diesen Antrag trotzdem bei der Vorstandschaft des Bürgernetzes und trug ihn selber vor. Auch die anderen Vorstandschaftsmitglieder, die meistens aus jungen Leuten bestehen, waren von der Idee begeistert und ließen durch den Techniker, Herrn Scheidler, die Möglichkeiten untersuchen. Das Ergebnis ist, daß der Bürgernetzverein der Bibliothek gestattet, eine Standleitung an den Teil des Servers zu legen, der dem Bürgernetzverein gehört. Dies muß jedoch noch heute Abend im Förderverein abgesegnet werden.
Von der finanziellen Seite ist so ein OPAC selbstverständlich nur durch die tatkräftige Unterstützung der Beratungsstelle bzw. der Generaldirektion zu verwirklichen. Nur mit der Aussicht auf Zuschüsse konnte ich unserer Stadtverwaltung die Notwendigkeit einer solchen Einrichtung vermitteln.
Ein weiterer Vorteil einer Standleitung, an den Server der Fachhochschule im Abschnitt des Bürgernetzes zu kommen, wäre, daß wir unsere beiden sowie einen dritten Rechner mit Internet-Zugang über diese Standleitung laufen lassen könnten.
Da die Telekom zur Zeit viele Konkurrenten bekommen hat, sind die Kosten für eine Standleitung sehr günstig geworden.
Die Kosten für die Einrichtung einer Standleitung durch die Telekom sind gekoppelt an die Vertragsdauer und reichen von: