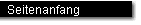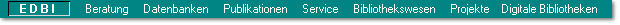


Öffentliche Bibliotheken und Schulbibliotheken:
ein spannungsreiches Verhältnis
Die anfängliche Meinungsführerschaft Öffentlicher Bibliotheken bei der Entwicklung der Schulbibliotheken in Deutschland war nicht frei von Fehleinschätzungen, Brüchen und Irritationen zwischen den Berufsgruppen der Bibliothekare und Lehrer. Eine Analyse des Geschehens zeigt die Problemfelder auf und skizziert die Möglichkeiten einer zukünftigen Entwicklung (1).
Andreas Papendieck
Es war bibliothekspolitisch richtig und auch notwendig, mit dem Aufkommen der bildungspolitischen Diskussion zu Beginn der 60er Jahre die Forderung zu erheben, Schulbibliotheken als Aufgabe der Öffentlichen Bibliotheken zu verstehen und sie somit folgerichtig in das Netz der Öffentlichen Bibliotheken zu integrieren. "Schulbibliotheken bilden mit öffentlichen Bibliotheken eine Funktionseinheit" so der Bibliotheksplan '73 und ähnlich das KGST-Gutachten aus dem gleichen Jahr.
Daß diese Forderung keine leere Floskel blieb, zeigen die Anstrengungen und auch die Erfolge, die dieser Aufbruchstimmung folgten. Der bildungs- und schulpolitische Impetus der damaligen Zeit und die bibliothekarischen Interessen gingen eine durchaus sinnvolle Symbiose ein, beispielsweise beim Bemühen um eine "Öffnung der Schule nach außen", beim "freien Curriculum" oder bei den "offenen Lernsituationen".
Das bibliothekspolitische Interesse zeigte sich in der unverhohlen zur Schau getragenen Absicht, sich neue Märkte zu erschließen - in diesem Fall der Lesermarkt der Schüler. Noch entscheidender war das Wahrnehmen der Chance im Rahmen der in völlig neuen Dimensionen geplanten Schulen - zumeist Gesamtschulen - Bibliotheksräume, ja auch Bibliotheksbauten zu bekommen, die in der Regel alles bisher Vorhandene weit übertrafen. Aus 40, 60 oder 80 qm wurden 200, 300, bis zu 1200 qm. Wer hätte da nicht sofort zugegriffen?
Und die Bilanz sieht heute nach 25 Jahren rein zahlenmäßig gesehen so schlecht nicht aus. Immerhin gibt es annähernd mehr als 30 Schulbibliothekarische Arbeitsstellen (SBA) bei den Stadtbüchereien, bei Schulämtern oder anderen Trägern. Eine gleiche Anzahl gibt es von beratungswilligen Staatlichen Fachstellen für Bibliotheken. Die Zahl der von ihnen bzw. den Öffentlichen Bibliotheken betreuten Schulbibliotheken ist nicht erfaßt. Aber mehrere hundert sind es. Soweit so gut!
Diese Geschäftigkeit verdeckt allerdings gravierende Strukturmängel des deutschen Schulbibliothekswesens. Was bei der Übernahme der neuen Schulbibliotheksaufgabe gern übersehen wurde, war die Begrenztheit des Konzeptes. Drei wesentliche Aspekte fehlten: die flächendeckende Organisationsstruktur, die den schulischen Bedürfnissen angepaßte Bibliotheksdidaktik und die Bereitschaft, auf neuere Entwicklungen im Medienbereich entschiedener zu reagieren.
- Organisationsstruktur
Die von offizieller Seite übertragene Aufgabe setzte zweifelsohne Energien frei - führte allerdings gleichzeitig zu einer völligen Dezentralisierung des Schulbibliothekswesens. Das Konzept sah keinerlei Netzbildung vor und die angewandten Normen ergaben sich häufig mehr durch Zufall als durch empirisch gesicherte Daten.
Im Unterschied zu den traditionellen Sonderbibliotheken - Musikbibliothek, Fahrbibliothek, Soziale Bibliotheksarbeit - handelte es sich um einen in der Bibliothekslandschaft neuen Typ, sowohl organisatorisch als auch von seinem inhaltlichen Auftrag her. Was seine Organisationsstruktur, seine Raumorganisation und seinen Wirkungsspielraum betraf, war diese Bibliotheksform vor ganz neue Probleme und Aufgaben gestellt. Besonders spannungsreich, zuweilen auch erschwerend, wirkte sich aus, daß man es mit einem Partner zu tun hatte, dessen Vorstellungen, Wünsche und Absichten hinsichtlich der Bibliotheksarbeit mit zu berücksichtigen waren.
Die zwangsläufig sehr unterschiedliche Ausgangssituation führte zu jenem bunten Flickenteppich, der das heutige Schulbibliothekswesen in Deutschland kennzeichnet, bestehend aus sehr großen und sehr kleinen Einrichtungen, sehr umfangreichen und sehr geschrumpften Beständen, personell hervorragend und personell sehr schlecht betreuten Bibliotheken, angebundenen, funktionierenden und nicht funktionierenden Einrichtungen. Diese Situation isolierte die einzelne Bibliothek und behinderte die weitere Gesamtentwicklung, so daß sie letztlich auf dem Status verharrt, den sie bereits in den 70er Jahren eingenommen hatte (2).
- Bibliotheksdidaktik
Das didaktische Konzept, das in den Schulbibliotheken von Anfang an mit Nachdruck vertreten wurde, war die Idee des "Informations- und Arbeitszentrums". Die Kernelemente waren bibliothekarische Kategorien wie Informationen sammeln, ordnen und auswerten - zumeist mit dem Zusatz 'kritisch'. Das Problem lag und liegt darin, daß man sich auf ein Konzept festgelegt hatte, das in der allgemeinen Diskussion über Schuldidaktik eine untergeordnete Rolle spielte und spielt. Das Sammeln von Informationen, der kritische Vergleich und die Überprüfung auf Richtigkeit ist ein Randthema der Schule. Die Einbindung in eine gesamtunterrichtliche Strategie stößt generell auf Schwierigkeiten.
Mit einer solchen Festlegung wurde der Zugang zu der Fülle der theoretisch vorhandenen und häufig auch praktisch durchgeführten Unterrichtsverfahren verbaut, zumindest erschwert. Die Vorstellung, daß durch Selbständigkeit bei der Informationsrecherche und der damit verbundenen Aufgabe einer kritischen Bewertung eine kopernikanische Wende in der Unterrichtsdidaktik eintreten würde, erwies sich als Illusion. Vielmehr wird die Diskussion schon seit längerem bestimmt von der Frage nach der offenen Lernsituation, deren Ziel es ist, eine Vielzahl von Unterrichtsmethoden, verbunden mit einem möglichst häufigen Lernortwechsel, miteinander zu verbinden. Dabei kommt den Methoden eine besondere Bedeutung zu, die die Emotionalität der Schüler mit einbeziehen und zu aktivieren verstehen. In einem so verstandenen Lernprozeß spielt die Bibliothek nur eine Rolle. Die Frage lautet allerdings, welche?
Die Antwort: "Eine untergeordnete Rolle", ist nichtssagend. Gravierender ist, daß eine Diskussion darüber, in welchen methodisch-didaktischen Kontext die Schulbibliotheksarbeit zu stellen ist, nicht stattfindet, weder auf pädagogischer noch auf bibliothekarischer Seite. Der Standpunkt, die Öffentlichen Bibliotheken seien dafür die falsche Adresse, kann als Verdrängung vor Verantwortung verstanden werden, denn sie sind sehr wohl auch zuständig. Sie sind zuständig, weil sie ein Produkt anbieten, das in der oben beschriebenen offenen Lernsituation dringend gebraucht wird. Voraussetzung allerdings ist die Kenntnis darüber wofür. Dieses "wofür" ist der Bedarf, der sich aus der Unterrichtspraxis ergibt. Mit anderen Worten: Schulbibliotheken müssen Marktanalyse betreiben. Nur so kann ein marktgerechtes Produkt 'produziert' werden.
- Die Non-Book-Medien
Die Integration der Non-Book-Medien in den Schulbibliotheksbestand war von jeher problematisch. Nur in Ausnahmefällen gelangen Lösungen, die organisatorisch und damit auch unterrichtsdidaktisch befriedigen konnten. Die praktizierten Modelle sind häufig Spiegelbild vorhandener Interessen und deren Durchsetzungsstrategien.
Die Frage der Integration tauchte auf, als Dias und Folien verstärkt im Unterricht Verwendung fanden. Virulent wurde das Problem, als AV-Medien den Rhythmus des Unterrichtsprozesses zu bestimmen begannen. Die gegenwärtige Situation in den Schulen ist nunmehr gekennzeichnet durch das rasante Anwachsen der Nutzung elektronischer Medien.
Die Nicht-Integration hat sich von Phase zu Phase verstärkt. Mit anderen Worten: AV- und elek-
tronische Medien wurden zunehmend von den Schulen in eigener bzw. separater Regie verwaltet. Diese Tendenz spitzt sich bei den elektronischen Medien in besonderer Weise zu. Es hat den Anschein - man könnte fast sagen, es droht die Gefahr -, daß diese Entwicklung an den Schulbibliotheken vollständig vorbeigeht. Auf die Gründe soll hier im einzelnen nicht eingegangen werden. Sie sind - wie so häufig - (manchmal allerdings auch als Zweckbehauptung) finanzieller, organisatorischer und auch personeller Natur. So läßt sich sicherlich manches erklären. Es ändert aber nichts an der äußerst prekären Tatsache, daß die Schulen allein an dieser Entwicklung beteiligt sind und - politisch von allen Seiten vehement unterstützt - einen beträchtlichen Erfahrungsvorsprung gewonnen haben.
Welche Dynamik diese Entwicklung inzwischen gewonnen hat, zeigt das Projekt "Schulen ans Netz" des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie und der Deutschen Telekom. Für das Jahr 1999 wurden erneut 100 Millionen DM bereitgestellt. Außerdem sind Mittel für die Lehrerfortbildung vorgesehen. Ergänzend zu diesem Projekt sollen Intranetlösungen für Schulen realisiert werden, die die Möglichkeit schaffen, das schulische und häusliche Lernen miteinander zu verbinden (3). Dazu kommt das ebenfalls vom BMBF und der Telekom geförderte Sonderprojekt "Infoschul" für die Sekundarstufe II (4).
Alle diese Initiativen kooperieren automatisch mit derjenigen Einrichtung der Schule, die sich bereits vorher mit dieser Thematik befaßt hat, d. h. in der Regel mit der Informatik-Abteilung, und die Ansprechpartner sind so verständlicherweise die Informatik-Lehrer.
Wie sehr das Schulbibliothekswesen in Deutschland dadurch weiter ins Hintertreffen gerät, kann man ermessen, wenn man die internationale Entwicklung zu diesem Thema verfolgt. Hier werden Theorie und Praxis des Internets (immer in Zusammenhang mit dem Medium Multimedia) ausschließlich auf die Schulbibliothek focusiert und über die Schulbibliothek für den praktischen Unterricht nutzbar gemacht. Informationsgewinnung und Informationsselektion gewinnen durch das Internet eine neue Qualität, was in Verbindung mit den traditionellen Informations- und Literaturquellen zu neuen didaktischen Möglichkeiten führt. In den angelsächsischen Ländern ist es unstrittig, daß der Schulbibliothekar die Vermittlerrolle in diesem neuen Medienprozeß zu übernehmen hat.
Vergleichbares ist in Deutschland nur vereinzelt anzutreffen. Als Beispiel soll ein Projekt der Stadtbücherei Mannheim genannt werden, das in Kooperation mit dem dortigen Schulverwaltungsamt und der Stadtbildstelle durch-
geführt wird. Seit März '99 wird in sechs kombinierten Schul- und Öffentlichen Bibliotheken sowie in einer schulinternen Bibliothek die Bereitstellung eines Multimedia- und Internetanschlusses mit erheblichen Landesmitteln gefördert, so daß die Schüler während und nach dem Unterricht die Möglichkeit haben, in der Bibliothek während der gesamten Öffnungszeit ungehindert zu recherchieren. Durch die Einbindung verantwortlicher Ansprechpartner bestehen somit Chancen, den Zugang zur Internetnutzung für ein sinnvolles didaktisches Unterrichtskonzept zu nutzen.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Weiterentwicklung der Schulbibliotheksarbeit im Bereich der Öffentlichen Bibliotheken stagniert, es teilweise sogar Rückschritte gibt, u. a. dadurch, daß Schulbibliotheken, bzw. Schulbibliothekarische Arbeitsstellen geschlossen werden oder aber deren Aufgaben an andere Institutionen abgegeben werden. Stagnation heißt: keine Neugründungen, keine Ansätze zu einer Netzbildung, keine berufspolitischen Zusammenschlüsse, keine berufspolitischen Vertretungen bei internationalen Gremien (Beispiel: IASL), keine mediendidaktischen Beiträge, kaum eine Weiterentwicklung hinsichtlich der unterrichtlichen Einbindung.
Nach den Gründen gefragt, trifft man auf folgende Antworten: Die finanzielle Verschlechterung der Öffentlichen Bibliotheken hat eine Besinnung auf Kernaufgaben erzwungen und zu einer Prioritätensetzung geführt. Dazu gehören nach landläufiger Meinung Schulbibliotheken nicht bzw. nicht mehr. Zudem geraten auch Schulbibliotheken ins Fadenkreuz der Kosten-/Leistungsrechnung, selbst dann, wenn sie als Zweigstellen fungieren. Um wieviel mehr, wenn es sich um reine Schulbibliotheken handelt, deren Ausleihkosten bis zu fünfmal höher sein können als die Ausleihkosten, die in einer Zweig- bzw. Hauptstelle anfallen.
Da der Ausbau des Zweigstellennetzes der Öffentlichen Bibliotheken in der Regel kein Thema mehr ist, würden sowieso nur schulinterne Lösungen in Frage kommen. Das liegt heute außerhalb der Primärinteressen. Sicherlich kommt auch eine immer wieder zu beobachtende Frustration über das mangelnde Interesse der Lehrerschaft hinzu, das die Bibliotheksarbeit häufig zu einem ständigen Klinkenputzen degenerieren läßt.
Aktivitäten neben den Öffentlichen Bibliotheken
Eine erkennbare Weiterentwicklung läßt sich nur außerhalb des Öffentlichen Bibliothekswesens erkennen. Zu nennen wären die staatlichen Verlautbarungen und Maßnahmen einzelner Kultusministerien der Bundesländer (5).
Hingewiesen wird hier auf das Land Sachsen-Anhalt, das seit 1991 als einziges Bundesland den Aufbau und die Betreuung von Schulbibliotheken kontinuierlich unterstützt. Mit dem Runderlaß des Kultusministeriums vom Juli '91 erhielten Lehrer für die Betreuung der Schulbibliothek Anrechnungsstunden in Abhängigkeit zur Schülerzahl. Mit der Änderung des Erlasses im Juni 1995 werden nun Anrechnungsstunden auf der Grundlage des vorhandenen Medienbestandes und der Schulform gewählt: An den Grundschulen zwei Stunden bei 500 Medieneinheiten, Lehrer an Sonderschulen, Sekun-
darschulen, Gymnasien, Gesamt-
schulen und berufsbildenden Schu-
len zwei Stunden bei 800 - 3.000 Medieneinheiten, drei Stunden bei 3.000 - 4.000 Medieneinheiten.
Seit 1994 fördert das Land die Schulbibliotheken auch finanziell. Der Runderlaß des Kultusministeriums vom August 1994 macht es möglich, Schulen beim Auf- und Ausbau von Medienbeständen und der Ausstattung mit Mobiliar im Rahmen der zur Verfügung stehenden Fördermittel zu unterstützen. Die Zuwendung der Mittel ist an folgende Voraussetzungen gebunden:
Zur fachlichen Unterstützung der Schulbibliotheken wurde der Aufgabenbereich der Fachstellen für öffentliche Bibliotheken erweitert. In allen drei Regierungspräsidien (Halle, Magdeburg und Dessau) wurden zunächst ABM-Stellen an den Fachstellen ein gerichtet und mit Diplom-Bibliothekarinnen besetzt.
Zu deren Aufgabenbereich gehört die:
Zu nennen ist ferner die Landesarbeitsgemeinschaft Schulbibliotheken in Hessen e.V. (LAG), über deren Zielsetzungen und Aktivitäten mehrfach in Schulbibliothek aktuell berichtet wurde. Es handelt sich um einen eingetragenen Verein von persönlichen und korporativen Mitgliedern. Die Aktivitäten sind vielfältig und erstrecken sich auf fast alle schulbibliothekarischen Gebiete. Sie sind so umfangreich, daß sie im Ausland (via Internet u. a.) oft als einzige deutsche Schulbibliotheksaktivität wahrgenommen werden. Daß es den Initiatoren gelingt, bei den Jahrestagungen i.d.R. 200 bis 300 Schulbibliotheksleiter (zumeist Lehrer) allein aus Hessen zusammenzutrommeln und ihnen ein abwechslungsreiches und informatives Programm bieten kann, verdient Anerkennung und Beachtung.
Ein anderer Bereich, der sich einer gewissen kontinuierlichen Weiterentwicklung erfreut und auch der Förderung durch seine Unterhaltsträger gewiß sein kann, sind Schulbibliotheken in Privatschulen - vornehmlich in den konfessionellen. Hier gibt es teilweise sehr großzügige Einrichtungen, die sogar immer wieder als Werbeträger eingesetzt werden. Häufig setzen diese Bibliotheken ältere Traditionen fort, da das Buch in diesen Schulen bereits früher eine wichtige Rolle spielte. Die Förderung durch die Schulleitung ist in vielen Fällen die Basis für die Akzeptanz durch Schüler und Lehrer.
Was ist zu tun?
Zunächst gilt, daß die Verantwortung bzw. Mitverantwortung der Öffentlichen Bibliotheken für die Schulbibliotheken nicht aufgegeben werden darf. Auch wenn Sparzwänge noch so sehr dazu verleiten sollten, kostenintensive Dienstleistungen aufzugeben, so darf nicht darüber hinweggesehen werden, daß die Folgen fatal wären. Die von den Öffentlichen Bibliotheken bisher geschaffenen Fakten sind Orientierungsdaten, auf die auch in Zukunft nicht verzichtet werden kann!
Auf der anderen Seite müssen sich die Öffentlichen Bibliotheken aber auch darüber im klaren sein, daß sie das, was sie wollen, alleine nicht erreichen können. Sie müssen mit Partnern zusammenarbeiten, die Aufgaben mit übernehmen können und wollen. Das wird durchaus verschiedentlich praktiziert, aber häufig mit einer Einstellung als sei einem der neue Partner nun doch wieder nicht so recht. Wer sich für die Gesamtentwicklung verantwortlich fühlt, sollte sich zu seinen Partnern auch unvoreingenommen voll bekennen.
Wenn es also gilt, in Zukunft auf zwei Schultern Wasser zu tragen, dann heißt das nichts anderes als: Offenheit nach außen bei gleichzeitiger Verantwortung für die Entwicklung im eigenen Haus. Im Unterschied zur Denkschrift des DBV von 1987, die eine Reihe von Forderungen an die einzelnen für Schulbibliotheken verantwortlichen Institutionen (Länder, Kommunen, Kreise, Ausbildungsinstitute) enthielt, können Appelle in Zukunft nur an die eigenen Mitglieder gerichtet werden. Dabei ist zu unterscheiden, zwischen den Möglichkeiten, die aufgrund der vorhandenen Einrichtungen bestehen und den Möglichkeiten, die sich als zukünftige Aufgaben abzeichnen.
Die Kooperation und Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Partner wird sich in erster Linie auf die Weiterentwicklung einer verbesserten Schulbibliotheksdidaktik beziehen. Schulbibliotheksdidaktik ist mehr als nur die kritische Sichtung und Bereitstellung von Literatur, ist mehr als nur eine akribische Erschließung. Schulbibliotheksdidaktik bedeutet zuverlässige Kenntnisse über die Einbindung der Medien in den Lehr- und Lernprozeß. Es sind Kenntnisse über Unterrichtsprozesse und über Methodenwechsel, über entdeckendes Lernen, exemplarisches Lernen, fächerübergreifendes und fächerverbindendes Lernen, über den fragend-entwickelnden Unterricht, das ganzheitliche Lernen und das handlungsorientierte Lernen. Die bibliothekarische Fragestellung bleibt dabei gleich: Welche Rolle spielt jeweils die Schulbibliothek und welchen spezifischen Beitrag leistet sie bei der erfolgreichen Durchführung der einzelnen Methoden?
Wieweit wir dabei noch am Anfang stehen, zeigt in den allermeisten Fällen die fehlende Rückkoppelung allein schon bei der Frage nach dem Nutzungseffekt der eingesetzten Medien. Weitgehend fehlen die Kenntnisse darüber, welche Literatur sich für welche Altersstufe besonders eignet und wie auf Lern- und Leistungsfähigkeit oder Gruppenarbeit mit den gezielt ausgewählten Medien einzugehen ist, damit sich der Unterricht in und mit der Bibliothek in der Tat effizienter und methodisch anregender abspielt als der traditionelle Klassenunterricht.
Die Zeit der Resolutionen und Deklamationen ist vorbei, zumal in einer Zeit in der Dezentralisation und stärkere Eigenverantwortlichkeit politische Leitlinien sind. Märkte lassen sich nicht durch Forderungen besetzen, sondern nur durch eine konsequente Angebotspolitik. Hier heißt das, es muß eine gezielte, den jeweiligen schulischen Bedürfnissen angepaßte Produktpalette bereitgestellt werden, da eine Vorortversorgung nur noch in Einzelfällen möglich sein wird.
In Anlehnung an das Projekt der Bertelsmann-Stiftung über neue Formen der Partnerschaft zwischen Bibliothek und Schule sollen drei mögliche Schwerpunkte beispielhaft genannt werden:
Eine solche Produktpolitik ist mit ihren Angeboten keineswegs völlig neu. Neu allerdings müßte sein, daß dieses Angebot als Markenzeichen aller Bibliotheken deutlich in Erscheinung tritt. Die generelle Akzeptanz durch das Bibliothekswesen wäre die Voraussetzung. Das äußere Erscheinungsbild der Listen und Werbematerialien bis hin zur Gestaltung der Medienkoffer muß einheitlich sein. Die Bibliotheken, die bereits hier erfolgreich operiert haben, berichten übereinstimmend von einer außerordentlichen Resonanz. Was die Klassensatzausleihe betrifft, meldet Duisburg eine Jahresausleihe von 34.000 Medieneinheiten und Mannheim von 20.000 Medieneinheiten. Die von einigen Stadtbibliotheken zusätzlich angebotenen Medienkoffer reichen grundsätzlich nie aus. Auch die Stadtbibliotheken in Bernburg, Bielefeld, Görlitz, Hannover, Hamm, Ingolstadt, Mülheim/Ruhr, Nürnberg, Offenbach, Siegen und einige andere bieten diese Dienste in unterschiedlicher Form an.
Wichtig ist eine sorgfältige Auswahl und ständige Verbesserung des Angebotes. Es muß den Anforderungen entsprechen, die heute an Unterricht und Lernen gestellt werden. Dabei sind die Prinzipien, die dem Unterrichtsverlauf zugrunde liegen, zu berücksichtigen. Sie müssen geeignet sein für das gemeinschaftliche Nachschlagen, für den Gruppenunterricht, für das Einzellernen, für das Schülerreferat, für die Bildverwendung. Sie müssen ggf. verwendbar sein für die Einstiegs- und Motivationsphase, wie auch ggf. für Reflexionen und für die Unterrichtszusammenfassung.
Offen bleibt die Frage, ob die Angebote kostenfrei bleiben sollen. Sobald die Schulen budgetiert sind und die Mittel zur eigenen Verwendung bereitgestellt werden, stellt sich bei den Schulen sehr schnell die Frage, welche Nutzungsformen für sie am kostengünstigsten sind. Auf diese Weise würde auch in Deutschland ein Weg beschritten, der in anderen europäischen Ländern bereits üblich ist (England) oder aber geplant ist (Italien). Damit sind sicherlich ganz neue Reize auch für Öffentliche Bibliotheken verbunden, Reize in Verbindung mit der Mobilisierung neuer Energien.
Allerdings ist es ein Irrtum anzunehmen, es handele sich hier um Schulbibliotheksarbeit. Es han-
delt sich lediglich um schulbibliothekarische Angebotsformen, die von den Öffentlichen Bibliotheken leistbar sind und sich in einem vertretbaren Kosten-/Leistungsverhältnis bewegen. Es ist ein Leistungsangebot, das Schulbibliotheksarbeit vor Ort unterstützen, ggf. ergänzen kann.
Denn Schulbibliotheksarbeit heißt nach wie vor:
Anmerkungen
(1) Gekürzter Vortrag des Autors, den er auf der Jahrestagung der DBV-Sektion II am 8. Mai 1998 in Freiburg gehalten hatte.
(2) An der Analyse, der 1982 erschienenen DBI-Schrift Neue Schulbibliotheken in der Bundesrepublik, brauchen auch heute keine Abstriche gemacht zu werden, allenfalls hat sich über die Szenerie ein weiterer Grauschleier gelegt, weil sich die Vereinzelung noch verstärkt hat.
(3) Quelle: http://www.san-ev.de/docs/09-03-99.asp
(4) Quelle: http://www.scientificconsulting.de/infoschool
(5) s. Schulbibliothek aktuell, 1999/1, S. 5 ff
(Prof. Andreas Papendieck, Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen Stuttgart)