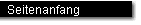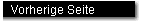
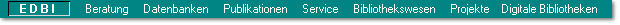


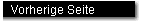
Dorothee Boeckh, Harald Schoppmann
Seit Beginn des Wintersemesters 1998/99 kann die Medizinisch-Wissenschaftliche Bibliothek des Klinikums Mannheim in Zusammenarbeit mit der UB Heidelberg Electronic Document Delivery als neue Dienstleistung anbieten: Wissenschaftler der Universität Heidelberg - zu denen auch die Angehörigen der Mannheimer Fakultät zählen - können direkt von ihrem Arbeitsplatzrechner Zeitschriftenartikel aus dem gemeinsamen virtuellen Zeitschriftenpool der UB und des Klinikums bestellen; die gewünschten Informationen werden i.d.R. binnen 24 Stunden per E-Mail und über das WWW zur Verfügung gestellt.
Geschichte
Im BIBLIOTHEKSDIENST 29.1995, Heft 11, S. 1797 berichten Annette Eckes und Eberhard Pietzsch über die damals noch relativ neue und unerforschte Möglichkeit der elektronischen Bestellung und Lieferung von Zeitschriftenaufsätzen, die in Heidelberg zum Wintersemester 95/96 als neue Dienstleistung der UB eingeführt wird.
Dieses Projekt wird in Mannheim von Anfang an mit Aufmerksamkeit und großen Hoffnungen verfolgt: unsere Bibliothek gehört trotz ihres externen Standortes zum Bibliothekssystem Heidelberg, da sie gleichzeitig nicht nur Bibliothek der Klinikum Mannheim gGmbh (= gemeinnützige GmbH) ist, sondern auch - mit dem größeren Teil ihrer Bestände - Bibliothek der Fakultät für Klinische Medizin Mannheim der Universität Heidelberg.
Und wenn es um die mehr oder weniger kostspielige Verbesserung der Literaturversorgung geht, sind die Zuständigkeiten bei zwei Unterhaltsträgern mit unterschiedlichen Interessen - Patientenversorgung einerseits, Lehre und Forschung andererseits - nicht immer befriedigend zu klären.
Das neue EDD verspricht nun nicht nur Möglichkeiten der Serviceverbesserung, sondern auch ein Einsparpotential.
Vorüberlegungen
Die besondere Situation der Mannheimer Fakultät und damit auch die ihrer zweischichtigen Bibliothekslandschaft führte in der Vergangenheit zu Sonderlösungen bei der Literaturversorgung vor Ort. Der Zeitschriftenpool wies z.B. Doppel- oder sogar Mehrfachabonnements auf. Ein Zustand, der nicht nur haushaltsrechtlich stets bedenklich war, sondern auch unter dem sattsam bekannten steigenden Kostendruck medizinischer Zeitschriften angesichts knapper werdender Etats nicht mehr haltbar ist.
In Heidelberg wird EDD nun nach anfänglich zögernder Inanspruchnahme sehr schnell von den Wissenschaftlern als unverzichtbares Instrument erkannt und genutzt.
Die Überlegungen der Bibliotheken gehen weiter: In einem ersten Schritt könnten die Zeitschriften der UB und unserer Bibliothek trotz verschiedener Standorte in einem virtuellen Pool zusammengefaßt und genutzt werden.
Vorteile:
In einer "konstituierenden Sitzung" im Sommer 1997, an der alle voraussichtlich Beteiligten aus Mannheim und Heidelberg, und zwar sowohl Bibliothekare als auch EDV-Spezialisten als auch der Geschäftsführer der Fakultät als Geldgeber teilnehmen, wird beschlossen, folgendes Projekt anzugehen:
Bildung eines virtuellen Zeitschriftenpools bestehend aus den (naturwissenschaftlichen) Zeitschriftenbeständen der Zweigstelle der UB und den zentral aufgestellten Zeitschriftenbeständen der Hauptbibliothek des Klinikums Mannheim; Schaffung der technischen Voraussetzungen für die elektronische Bestellung und Lieferung von Aufsätzen aus diesem Pool für die Wissenschaftler der Universität.
Die UB sagt sowohl die Nutzung der von ihr entwickelten Software als auch die Unterstützung bei der Software-Anpassung und Bestandsdaten-Implementierung zu. Die Fakultät sichert die Bereitstellung der Finanzmittel zur Anschaffung der benötigten Hard- und Software und die Unterstützung des EDV-Beauftragten der Fakultät ebenso zu, wie die Mittel zur Einstellung studentischer Hilfskräfte für den laufenden Betrieb des Ganzen. Die Klinikum Mannheim gGmbH wird weder finanziell noch personell involviert.
Die Bibliothekskommission der Fakultät Mannheim wird von dem Vorhaben informiert und läßt sich wider Erwarten vom Optimismus der Bibliothek anstecken. Dem Hinweis, daß dieser Dienst nur für zentral aufgestellte Bände eingeführt werden kann, wird allerdings keine Bedeutung beigemessen. Einmalige Sondermittel sollen den Zeitschriftenpool erweitern und Abbestellungen in größerem Umfang vermeiden.
Dennoch kündigt die Bibiliothek in einem ersten Schritt alle Doppelabonnements von Zeitschriften in Mannheim unter Hinweis auf die geplante Dienstleistung. Nach dieser hausinternen Bestandsbereinigung werden die Doppelabonnements mit der UB einer Prüfung unterzogen - Standortentscheidungen werden getroffen.
Summa summarum wird - wenn auch vielleicht nur für die Bibliotheken erkennbar - eine Straffung der Bestände und damit die bessere Ausnutzung der Ressourcen erreicht.
Die Mannheimer Zeitschriftenbestände werden so weit wie möglich zentralisiert, wobei das in dieser ersten Phase nur zu "glatteren Schnitten" bei der Altbestandsaufstellung führt. Die letzten zehn Jahrgänge - und damit die für EDD interessante Literatur - steht in vielen Fällen noch vor Ort in den Kliniken und Instituten und damit dem neuen Service nicht zur Verfügung. - Dies wird sich erst 2001 mit dem Bezug des neuen multifunktionalen Forschungsgebäudes und der damit verbundenen Einrichtung einer "echten" Zentralbibliothek ändern.
Begünstigende Entwicklungen
Die Vernetzung der Kliniken und Institute in Mannheim schreitet in der Zwischenzeit zügig voran. Firewall- und Mail-Server werden aufgebaut. Internet-Zugänge werden ermöglicht.
Die Bibliothek baut (mühsam) eine Homepage auf, die den Benutzern alle wünschenswerten Hilfen anbietet und u.a. EDD per Mausklick ermöglicht.
Zusätzlich spielt uns die Entwicklung bei den Verlagen in die Hände: Springer-LINK z.B. bietet die Möglichkeit einer Campus-Lizenz. Andere Verlage bieten den Volltext ihrer Titel zu unterschiedlichen Konditionen online abrufbar an. Eine Entlastung für den geplanten Pool bzw. den Arbeitsanfall beim Einscannen der Dokumente.
MEDLINE ist plötzlich kostenlos im Internet zu haben: sämtliche MEDLINE-CD-Abonnements - in Mannheim immerhin 14! - werden gekündigt und die Mittel zugunsten anderer Zeitschriften und damit zugunsten des Pools verwendet.
Auch bei den Bibliotheken tut sich in dieser Zeit einiges. Z.B. nimmt SUBITO den Probebetrieb auf und führt zu einer weiteren Verbesserung des Dienstleistungsangebotes.
Umsetzungsschritte
Die Platzreserven unserer Bibliothek sind wie überall vollkommen ausgereizt. Ein geeigneter Raum für das EDD-Projekt kann nur in einem etwas entfernt liegenden Gebäude gefunden werden. Dies bedingt Büchertransporte mit der hauseigenen Containeranlage, die Zeit kosten.
Schon 1997 werden aus Fakultätsmitteln Scanner, PC und Drucker und die erforderliche Software analog zur UB-Ausstattung gekauft. Die Kosten für diese EDD-Station belaufen sich auf ca. DM 35.000.
Ein Abzug der Zeitschriftendatenbank für die beiden Bibliotheken muß für die neuen EDD-Bedürfnisse aufbereitet werden. Fehler in den Bestandsangaben werden erst später im Echtbetrieb entdeckt werden. Das Zusammenführen der Bestände in einer Datenbank bereitet einige Mühe aufgrund der dezentral aufgestellten Mannheimer Bestände, die herausgefiltert werden müssen. Bei unterschiedlichen Beständen in Mannheim und Heidelberg werden ggf. zwei Standorte nachgewiesen; der Benutzer entscheidet, wo er bestellen möchte.
Der Nutzerkreis bleibt unverändert bestehen: jeder wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität Heidelberg sowie der Klinika Heidelberg und Mannheim. Die Nutzung soll bis auf weiteres kostenlos sein.
Der Personaleinsatz wird geplant: Der 1995 für möglich gehaltene Dauerbetrieb mit studentischen Hilfskräften hat sich mangels zuverlässiger Anwesenheit derselben insbesondere in den Semesterferien nicht bewährt. Mittlerweile wird EDD von Stammpersonal im mittleren Dienst erledigt. In Mannheim soll ebenfalls Stammpersonal, evtl. unterstützt von Hilfskräften, eingesetzt werden - vorläufig zu Lasten anderer Tätigkeiten. Der tatsächliche Personalbedarf wird sich voraussichtlich bei ca. 0,5 Stellen einpendeln.
Technische Umsetzung
Das HEDD-System der Universitätsbibliothek Heidelberg war ursprünglich als reine Einzelplatzversion konzipiert. Es bestand aus einem LINUX-System, auf dem ein WEB-Server als Benutzerschnittstelle eingesetzt wird. Anwender können nach erfolgreicher Authentifikation über ein Formular Artikel bestellen bzw. fertige Scanns (in verschiedenen Formaten) abrufen.
Die eigentlichen Scannarbeiten erfolgen, nach dem lokalen Ausdruck der Aufträge, auf einem PC unter Windows 3.1 mit einem MINOLTA PS3000P Buchscanner. Die Scanns werden anschließend über ein lokales Netz auf den LINUX-Rechner übertragen, auf dem die Weiterverarbeitung erfolgt.
Für die Integration zusätzlicher (dezentraler) Scannarbeitsplätze mußte dieses Konzept erweitert werden. Die Aufträge müssen zuerst auf die zuständigen Standorte verteilt und nach dem Scannen auf dem LINUX-Rechner wieder zusammengeführt werden. Die Übermittlung der Aufträge läßt sich leicht mit E-Mail realisieren. Schwieriger ist die Übertragung der fertigen Scanns, weil am Standort Mannheim ein sehr restriktives FIREWALL-System die möglichen Übertragungsprotokolle einschränkt. Der Datentransfer muß deshalb per FTP stattfinden, wobei ein manueller Login-Vorgang auf dem FIREWALL eine automatische Übertragung erschwert. Mit Hilfe eines TCL-Skripts und des Programms EXPECT, mit dem sich beliebige Anwendungen "fernsteuern" lassen, konnte das Problem befriedigend gelöst werden.
Der Arbeitsablauf im Klinikum Mannheim erfolgt etwa nach folgendem Schema:
Neben der technischen Auslagerung eines Scann-Standortes sind natürlich noch weitere Änderungen am System notwendig gewesen. Hierzu gehören die Erweiterung der Zeitschriftendatenbank um Bestands-Standort-Informationen und Ergänzungen am Bestellformular. Die Auswirkungen auf die Benutzerschnittstelle konnten jedoch so gering gehalten werden, daß die Bedienung weitgehend gleich blieb.
Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Behandlung von Fehlbestellungen. Die Ursachen können entweder beim Benutzer (falsche oder unvollständige Angaben) oder bei der Bibliothek (Zeitschrift momentan nicht verfügbar, technische Probleme, etc.) liegen. Hierfür wurde auf dem HEDD-Server ein WEB-Interface eingerichtet, das es den Mitarbeitern ermöglicht, entsprechende Fehlermeldungen an die Benutzer zu übermitteln.
Ergebnisse
Nach Schaffung des virtuellen Zeitschriftenpools Heidelberg-Mannheim umfaßt das Angebot an elektronisch lieferbaren Zeitschriften im Bibliothekssystem Heidelberg derzeit 4.200 Titel (vorher 3.500) bzw. 1.450 laufende Abonnements (vorher 1.200).
Den Mannheimer Benutzern stehen außerdem zur Verfügung:
Die Nutzung der erweiterten Dienstleistung hat sofort eingesetzt: von 140 Anfragen an den neuen Standort Mannheim im Startmonat September über 255 im Dezember ist die Tendenz steigend bis zu 594 Anfragen im Januar. Dies ist zum großen Teil auf die bereits existierende "Fan-Gemeinde" - im Oktober waren das 1.354 eingetragene EDD-Nutzer - zurückzuführen.
Knapp die Hälfte aller bisherigen Anforderungen (48%) an den Standort Mannheim kamen aus dem Klinikum selbst, d.h. es handelt sich um Bestellungen aus den dezentralen Kliniken und Instituten auf die zentral aufgestellten Bestände. Damit stellt sich zum einen der Zentralbestand als erfreulich gut sortiert heraus, zum andern gewinnt die Bedeutung der zentralen Aufstellung bereits jetzt an Gewicht.
Interessanterweise ist es sehr schwierig, die neue Dienstleistung bei allen potentiellen Nutzern publik zu machen: trotz weiter Streuung handlicher Faltblätter und großformatig aushängender Infoblätter, einem Anschreiben der Bibliothek an die Klinik- und Instituts-Chefs und der UB an alle Lehrstuhlinhaber - und natürlich der Präsentation auf der Homepage verbreitet sich das Wissen um den neuen Dienst und das Know How dazu nur schleppend.
Desinteresse? Andere Quellen? - Bibliotheken zweifeln ja sofort an sich selbst.
Es stellt sich heraus, daß die Vernetzung der verschiedenen Gebäude längst nicht so weit fortgeschritten ist wie angenommen. In Gesprächen mit (potentiellen) Nutzern erfahren wir auch, daß diejenigen, die von EDD wissen und es bedienen können, diese Information nicht unbedingt weitergeben. Manche - die gerade nicht unter dem Zugzwang einer geplanten Veröffentlichung stehen - wissen auch davon, haben aber keine Zeit (oder keine Lust), sich damit zu beschäftigen. Viele lassen auch die Literaturbeschaffung für sich erledigen und treten damit selbst nicht als Nutzer in Erscheinung.
Dennoch bleibt die Frage: Warum verbreitet sich so ein Wissen nicht schneller? - Um die "Vermarktungsstrategie" müssen wir uns noch einmal gesondert bemühen, da sind wohl längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
Wie geht es weiter?
Wenn der Neubau im Jahre 2000 oder 2001 bezogen ist und die Zeitschriftenbestände des Mannheimer Klinikums nach und nach zentral aufgestellt sein werden, wird die angebotene Titelmenge um weitere 300 Abonnements steigen - vorausgesetzt, wir können sie dann noch finanzieren.
Der Gesamt-Bestand der bis Sommersemester 1998 noch selbständigen Bereichsbibliothek des Theoretikums der Universität Heidelberg wird derzeit in die UB eingegliedert. In absehbarer Zeit werden auch diese Zeitschriftenbestände und damit weitere 150 laufende Abonnements für EDD zur Verfügung stehen. Vielleicht kommen weitere Bestände aus anderen Bereichen des Heidelberger Bibliothekssystems hinzu. - Die Versorgung vor Ort wäre dann perfekt!