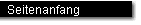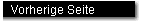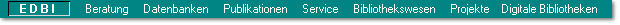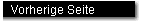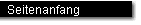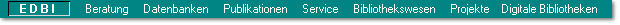


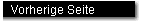

BIBLIOTHEKSDIENST Heft 5, 98
Thesen zur Zukunft des Fachreferenten
Sabine Wefers
Der vorliegende Text versteht sich als Beitrag zu einer Diskussion, die in den vergangenen Monaten um die Ausbildung und - damit zusammenhängend - das Aufgabenprofil des Höheren Dienstes geführt wurde1). Die Autorin wurde gebeten, für eine Podiumsdiskussion, die vom VDB-Landesverband Baden-Württemberg (im April 1998) veranstaltet wurde, eigene Thesen zu erarbeiten. Diese sollen im folgenden vorgestellt werden.
Das Fachreferat heute
An dieser Stelle sollen nicht alle denkbaren Aufgaben des Fachreferenten aufgeführt werden. Allerdings erscheint es für die weiteren Ausführungen wichtig, die zentralen Tätigkeitsbereiche des Höheren Dienstes in wissenschaftlichen Bibliotheken noch einmal kurz zusammenzustellen:
- Im Fachreferat fällt die Erwerbungsentscheidung im Rahmen eines Konzepts zum Bestandsaufbau, wobei dieses Programm in den meisten Bibliotheken nach wie vor relativ unscharf ist. Das Erwerbungskonzept einer Bibliothek wird von der zuständigen Abteilungsleitung und/oder der Direktion im Zusammenwirken mit den Referenten erarbeitet und gepflegt. In einschichtigen mehr als in zweischichtigen Universitätsbibliotheken kommt die Erwerbungskoordination mit dem jeweils einschlägigen Fachbereich hinzu. In den letzten Jahren konnte es sich allerdings kaum eine Bibliothek leisten, ihren Bestand nur aufzubauen; deshalb gehört inzwischen aus finanziellen Gründen auch das Abbestellen zum Alltagsgeschäft. Wie bei den Erwerbungskonzepten gilt auch für diesen Bereich der Bestandsentwicklung, daß das Konzept für eine sinnvolle Reduktion (Evaluierung) bislang in den meisten Fällen unscharf blieb.
- Im Fachreferat erfolgt die sachliche Erschließung der erworbenen Medien. Dies erfolgt in der Regel für die selbständig erschienenen Schriften unter Nutzung der Fremdleistungen (RSWK, Regensburger Systematik, Basisklassifikation). Bei Freihandbibliotheken kann auch eine bibliothekseigene Aufstellungssystematik angewandt werden. Des weiteren kommt bei Spezialsammlungen oder Sondersammelgebieten häufig noch eine tiefergehende Sacherschließung hinzu. In einigen Bibliotheken werden zudem bibliographische Unternehmungen gepflegt, die auch unselbständig erschienene Werke einbeziehen.
- Im Fachreferat werden in der Regel auch speziellere Auskunftstätigkeiten erledigt; das kann sich auf die kollegiale Hilfe bei schwer auffindbaren Titeln im Rahmen des Signierdienstes ebenso beziehen wie auf die Beratung von Bibliotheksbenutzern mit speziellen Anfragen oder die Bearbeitung entsprechender Korrespondenz.
- Neben dem eigentlichen Fachreferat werden in zunehmendem Maße Organisations- und Verwaltungsaufgaben übernommen, in der Regel Abteilungsleitungen.
Das Fachreferat übermorgen
Selbstverständlich kann hier und heute kein Patentrezept dafür entwickelt werden, nach dem sich das Fachreferat zu einem "Erfolgsmodell der Zukunft" entwickeln könnte. Nur eines scheint gewiß zu sein: Weder diejenigen, die das Fachreferat in seiner überkommenen Form unverändert beibehalten wollen noch diejenigen, die sein Ende bereits als Faktum behandeln, dürften die Anforderungen der Zeit richtig gedeutet haben. Im folgenden sollen die zuvor angesprochenen Grundtätigkeiten in Hinblick auf ihre (mögliche) mehr oder minder ferne Entwicklung angesprochen werden.
- In puncto Erwerbungsentscheidung erscheint es wesentlich, wie weit es den Bibliothekaren gelingen wird, die Bestandsentwicklung methodisch einwandfrei zu definieren. Hier muß ein Profil entstehen, das Außenstehenden (Geldgebern wie Benutzern) transparent macht, welche Medien in welcher Intensität (Sammeltiefe) erworben werden. Hinzu kommt eine qualifizierte Aussage darüber, welche Medien nicht mehr selbst erworben, sondern nur noch vermittelt werden. Letzteres kann sich zum Beispiel auf die Aufgabe eines teuren Zeitschriften-Abonnements zugunsten eines kommerziellen Dokument-Lieferdienstes im Bedarfsfall beziehen (Access versus Ownership). Insgesamt muß der Evaluierung einer Entscheidung für eine Erwerbung oder Nicht-Erwerbung (z. B. eine Zeitschriftenabbestellung) ein hohes Gewicht zukommen. Dies kann auf Grund der fachwissenschaftlichen Vorbildung in Kombination mit seiner bibliotheksfachlichen Erfahrung am besten der Fachreferent leisten. Dagegen läßt sich die Tendenz beobachten, die Einzelentscheidung für den Erwerb eines Werkes mit zunehmender Geldknappheit in Zukunft nicht mehr (oder zumindest nicht mehr ausschließlich) in die Hand des Fachreferenten zu legen. Statt dessen wird diese Entscheidung in Universitäten wohl größerenteils an die Hochschullehrer übergehen; in einschichtigen Systemen dürfte dies vielfach schon dem Alltag entsprechen. Um so wichtiger wird dann natürlich das zuvor angesprochene Bestandsprofil, mit dessen Hilfe der koordinierende Referent Defizite im vereinbarten Bestandsaufbau aufspüren und diese beheben bzw. die Behebung einfordern kann. Neben der Verlagerung bestimmter Anteile des Bestandsaufbaus auf die Endnutzer dürften in Zukunft Profil-Lieferdienste, Regionalreferate oder sonstige Dienstleistungen die konventionelle Kaufentscheidung durch den Fachreferenten im Routinefall zunehmend erleichtern, wenn nicht sogar ersetzen. Dem Fachreferenten bleiben die Koordination, die Qualitätskontrolle der Profile und die Evaluierung der Bestandsentwicklung sowie der ergänzende Kauf. Wenn das Fachreferat auf diese Weise die Planung und das Controlling übernimmt, muß es die Zukunft nicht fürchten. Wo (nach wie vor relativ viel) Geld ausgegeben wird, rentiert sich eine solche Arbeitsstelle immer. Allerdings muß der Referent diesem Anspruch auch gerecht werden; hier besteht die Notwendigkeit zu stärkerer methodischer Qualifizierung in Aus- und Fortbildung.
- Die sachliche Erschließung der erworbenen Medien wird sich kaum als eines der Haupttätigkeitsbereiche des Fachreferenten behaupten. Im Bereich der verbalen Sacherschließung gibt es bereits heutzutage zahlreiche umfangreiche Fremdleistungen, zum Beispiel für die deutschen Titel von seiten der Deutschen Bibliothek. Neben diesen Fremdleistungen finden sich in den Sacherschließungsabteilungen zunehmend mehr Kolleginnen und Kollegen des Gehobenen Dienstes, die zumindest das Regelwerk mindestens ebenso gut beherrschen wie der Höhere Dienst. Da diese Fachkräfte Routinefälle erfahrungsgemäß ohne weiteres bearbeiten können, werden sie nolens volens zu einer preiswerten Konkurrenz für das Fachreferat. Künstliche Riegel gegen diese "Nebenbuhler" vorschieben zu wollen, dürfte etwa die gleiche Aussicht auf Erfolg haben wie auf allen anderen Gebieten, wo derart artifizielle Schranken aufgebaut wurden: Sie verlangsamen den Prozeß höchstens, verhindern tun sie nichts. Warum auch? Wo der Höhere Dienst nicht unbedingt benötigt wird, ist sein Einsatz schlicht zu teuer. Neben dieser "Nebenbuhlerschaft" von seiten des Gehobenen Dienstes tun sich auch technische Alternativen auf, die bei streng wirtschaftlicher Betrachtung zu einer starken Konkurrenz werden dürften: Das maschinelle Indexieren von Titeldaten führt quasi zu einer Automatisierung der verbalen Sacherschließung; eine automatische Klassifikation hingegen wird es wohl nur da geben können, wo eine bereits vorhandene inhaltliche (Zu)Ordnung dies ermöglicht. Einwenden kann man gegen eine Automatisierung in diesem Bereich, die Qualität sei unbefriedigend. Das mag sogar richtig sein: Aber im Falle einer Kosten-Nutzen-Analyse werden die Befürworter eines vergleichsweise hohen intellektuellen Aufwands für die Inhaltserschließung nur schwer bestehen können. Was sinnvoll und vertretbar sein dürfte, wird die komplementäre Sacherschließung sein: Wenn ein Titel nicht aussagekräftig oder mehrdeutig ist, wird sich der Fachreferent z. B. für eine ergänzende verbale Verschlagwortung entscheiden. Oder die Titel werden vermutlich im Verbund (wie z. B. heute schon im GBV) und ggf. unter Nutzung von Fremdleistungen (grob) klassifiziert. Auch hier dürfte der Gehobene Dienst übrigens auf Dauer in zunehmendem Maße mitwirken. Daneben müssen natürlich bibliothekseigene Aufstellungssysteme gepflegt werden. Für Spezialsammlungen, bibliographische Unternehmungen etc. wird der Fachreferent eine tiefgehende Erschließung durchführen, sofern und solange diese Dienstleistung nachgefragt wird. Im Bereich der Inhaltserschließung wird es also ebenso wie im Punkt "Erwerbung" zu einer Verlagerung des Schwerpunkts der Aufgaben weg vom Routine-Einzelfall hin zur Planung, zum Controlling und zu komplementären Dienstleistungen kommen. Auch hier bestehen Defizite in der einschlägigen Fachkompetenz, zum Beispiel auf dem Gebiet der Systematikpflege.
- Der Bereich der speziellen Auskunftstätigkeiten dürfte die "Wachstumsbranche" des Fachreferats werden. In zunehmendem Maße spiegelt sich hier die Dienstleistungsorientierung einer Bibliothek wider. Vom "Internet für Anfänger" bis zur Frage "Welche Medien sind für welche speziellen Fragestellungen relevant? Und wie kommt man zu den jeweils einschlägigen Arbeitsmaterialien?" kann der Fachreferent ein breites Spektrum von Benutzern ansprechen. Hier ist eine sorgfältige Bedarfsanalyse wichtig. Das Angebot muß sowohl zielgruppenorientiert wie qualifiziert sein, um auch die zu überzeugen, die ansonsten nach eigener Einschätzung "selbstverständlich auch allein zurechtkommen würden". Wenn der Service stimmt, wird er allerdings auch in Anspruch genommen! Vielleicht läßt sich auf Dauer zum Beispiel mit den Fachbereichen ein entsprechendes Veranstaltungsangebot für Studieneinsteiger vereinbaren. Für die so gewonnene Klientel könnte das Fachreferat dann ein begleitendes Informationsvermittlungsangebot bis zum Examen und ggf. sogar darüber hinaus erarbeiten. Um ein derart gutes Profil zu entwickeln, müssen allerdings beide Seiten "stimmen": das fachwissenschaftliche Verständnis für das Problem und die "bibliothekarisch-technische" Seite seiner Lösung. Dies bezieht sich wohlgemerkt nicht allein auf die neuen Medien, sondern auf eine benutzerorientierte Zusammenstellung aus dem gesamten Repertoire der verfügbaren Informationsquellen. Hier dürfte ein kontinuierlicher Fortbildungsbedarf auf dem Informationssektor bestehen.
- Der Anteil des Höheren Dienstes an Organisations- und Verwaltungsaufgaben wird hoch sein müssen, wenn die Dienstleistungsorientierung der Bibliothek für wissenschaftliche Nutzer erhalten bleiben soll. Der zügige Geschäftsgang gehört ebenso zu diesem Bereich wie die Planung, Gestaltung, Durchführung und eine Erfolgskontrolle, und zwar in bezug auf neue Angebote genauso wie in den "klassischen" Bereichen z. B. der Bestandsentwicklung. Die oben angeführten inhaltlichen Strategien müssen entwickelt und - gemeinsamen mit dem Gehobenen und mit dem Mittleren Dienst - umgesetzt und bei Bedarf angepaßt werden. Dabei fällt dem Höheren Dienst die Rolle des Koordinators zu, dessen Aufgabe darin besteht, sein eigenes Expertenwissen mit dem der anderen Beteiligten zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzufügen. Eine gute Idee kann nämlich nur dann zum Erfolg werden, wenn sie allen Beteiligten vermittelt und organisatorisch wie fachlich optimal umgesetzt wird. Das kann eine umfassende "Management-Aufgabe" sein, die das ganze Haus betrifft und nicht allein von einem Fachreferenten geleistet werden kann. Es kann aber auch schlicht eine Frage der Selbstorganisation und Selbstdisziplinierung sein. Der Fachreferent wird stärker als je zuvor zu einem Teil des "Dienstleistungsunternehmens Bibliothek" werden, wobei dieses Unternehmen zunehmend stringent organisiert sein dürfte. Die Zeit des Fachreferenten als "Einzelkämpfer" mit dem entsprechenden individuellen Spielraum neigt sich damit sicher ihrem Ende zu. Das mag so mancher persönlich als Einschränkung empfinden, für die Berufsgruppe stellt diese Integration und die damit einhergehende Veränderung des Aufgabenprofils jedoch eine nicht zu unterschätzende Chance dar.
Der gelehrte Bibliothekar entfernt sich immer mehr weg vom Spitzweg-Image hin zum Vermittler zwischen den Ansprüchen der Wissenschaft und dem professionellen Know-how. Insofern sollte der Fachreferent sich auf keinen Fall historisch rückwärts orientieren, sondern nach vorn schauen und sich entsprechend weiter qualifizieren. Dabei sind die oben ausgeführten Thesen bewußt mit "Das Fachreferat übermorgen" betitelt, um der Autorin den Vorwurf zu ersparen, man könne doch einem gestanden Kollegen nicht zumuten, sich derart grundlegend neu zu orientieren. Das sei doch weltfremd. Das mag im biologischen Einzelfall sogar zutreffen. Aber: Erstens ist hier eine weitergehende Qualifizierung angesprochen worden; so etwas braucht bekanntlich seine Zeit. Und zweitens läßt sich häufig sogar in der eigenen Bibliothek zeigen, daß die Flexibilität und die Professionalität gerade des Höheren Dienstes oft unterschätzt wird. Dabei liegt der viel beschworenen Unbeweglichkeit unserer Berufsgruppe vielfach schlicht das Fehlen klarer Zielvorstellungen und häufig wohl auch ein mangelndes Problembewußtsein zugrunde. Nur: Haben wir das erkannt, ist zumindest der Mangel an Problembewußtsein schon halbwegs überwunden. Und hinsichtlich der Zielvorgaben sollten wir ja wohl in der Lage sein, die Ansprüche der Zeit zu erkennen und daraus unsere Schlüsse zu ziehen. Nicht umsonst verfügen wir über ein beachtliches Kapital: eine akademische Ausbildung und die bibliothekarische Fachkenntnis. Und wir haben Freude an geistiger Arbeit. Sonst hätten wir den Beruf nämlich sicher nicht gewählt.
1) In dieser Zeitschrift erschienen in einem Heft gleich zwei Beiträge zum Thema: Jochum, Uwe: Die Situation des Höheren Dienstes, in: BIBLIOTHEKSDIENST, 32. Jg. (1998), H. 2, S. 241-247 und Oehling, Helmut: Wissenschaftlicher Bibliothekar 2000 - quo vadis?; BIBLIOTHEKSDIENST, 32. Jg. (1998), H. 2, S. 247-254.
Stand: 13.05.98