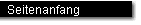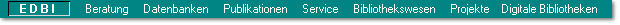


| Bibliothek | Die Deutsche Bibliothek Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main |
| Anschrift | Adickesallee 1 60322 Frankfurt/Main Tel: 0 69 / 15 25-0 Fax: 0 69 / 15 25-10 10 E-Mail: info@dbf.ddb.de Internet: http://www.ddb.de |
| Bundesland | Hessen |
| Bibliothekstyp | Nationalbibliothek |
| Eröffnung | 1996 |
| Hauptnutzfläche | 47.000 |
| Bestandsgröße | 5.000.000 |
| Einwohner Einzugsbereich | |
| Benutzerplätze | 350 |
| Art der Baumaßnahme | Neubau |
| Gebäudetyp | keine Angaben |
| Gebäudenutzung | Bibliothek |
| Gesamtkosten | 250.000.000 |
| Baukosten | keine Angaben |
| Einrichtungskosten | keine Angaben |
| Technische Ausstattung | Elektro-Transportwagen, Behälterförderanlage (Telelift), Buchsicherungsanlage (3 M), Kompaktregalanlage (Mauser) |
| Einrichtung | ekz / Reutlingen, Mauser / Waldeck, VS / Tauberbischofsheim (Tische,Stehpulte,Ztschr.-ständer), Schöninger (Vitrinen), Hänseroth / Mühltal (Leitsystem), Vitra (Stühle), Betz (Bücherwagen), Expresso / Kassel (Elektro-Transportwagen) |
| Planung | Arat - Kaiser - Kaiser / Stuttgart |
| Literaturauswahl | Deutsche Bibliothek in Frankfurt am Main. - In: wettbewerbe aktuell (1997) 6, S. 97-99 Jopp, R. K.: Der Neubau für Die Deutsche Bibliothek in Frankfurt am Main. - In: ABI-Technik 17 (1997) 2, S. 117-128 Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main : ein Dialog zwischen Architekten und Bibliothekaren ; e. Veröff. d. Gesellsch. für d. Buch e.V. / hrsg. v. K. - D. Lehmann u. I. Kolasa in Zusammenarb. mit Arat-Kaiser-Kaiser. - Ostfildern-Ruit : Hatje, 1997 Kolasa, I.: Dem Nützlichen und Zweckmäßigen verpflichtet. - In: Dialog mit Bibliotheken (1994) Sondernummer Der Neubau der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main, S. 9-11 Lehmann, K. - D.: Haus der Bücher - Elektronisches Archiv. - In: Dialog mit Bibliotheken (1997) Sondernummer Der Neubau der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main, S. 8-10 Liegmann, H., Schwens, U.: Elektronisch ? Kein Problem !. - In: In: Dialog mit Bibliotheken (1997) Sondernummer Der Neubau der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main, S. 11-14 Der Neubau der Deutschen Bibliothek : Dokumentation zum 2. Architektenwettbewerb / [Dt. Bibliothek. Bearb.: Reinhard Rinn]. - Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1984 (Sonderveröffentlichungen der Deutschen Bibliothek ; Nr. 14) Die neue Nationalbibliothek : Ergebnisse des Architektenwetttbewerbs Neubau der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main / Sonderdruck. - Frankfurt am Main : Buchhändler-Vereinigung, 1983 Reisser, M., Kolasa, I.: Das Konzept "Gutenberg" im Zeitalter von Multimedia und Internet oder Warum der Abschied von den "Buchmuseen" Schwerfallen sollte : Beiläufige Anmerkungen aus Anlaß des Neubaus der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main. - In: BuB 49 (1997) Sonderheft Bibliothekskongreß, S. 32-38 Rinn, R.: Der Neubau der Deutschen Bibliothek. - In: ABI-Technik 3 (1983) 3, S. 185-192 |
| Unterlagen im DBI-Bauarchiv | Pläne vorhanden Bildmaterial Baubeschreibung Bibliotheksbeschreibung Eröffnungseinladung Festreden Festschrift/Eröffnungsbroschüre Flächenberechnung Funktionsbeschreibung Gebäudebeschreibung Isometrie (Gesamtansichten) Planungsgeschichte Prospekt / CSC Ploenzke (Multimediabereitstellung) Prospekt / EKZ Prospekt / Expresso (Elektrowagen) Prospekt / Mauser Video Wettbewerbsunterlagen Zeitungsartikel |
| Baubeschreibung | Schon 1981/82 war ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben worden, um den in Frankfurt dringend benötigten Neubau zu konzipieren. In der zweiten Stufe des Architektenwettbewerbs hatten die Stuttgarter Architekten Arat/Kaiser/Kaiser den Siegerentwurf geschaffen. Als Bauplatz ist ein ca. 19.000 qm großes Grundstuck am Rande eines parkartigen Villenviertels an der Westseite und einer vier- bis sechsgeschossigen Blockrandbebauung an der Ostseite, an der Kreuzung zweier vielbefahrener Magistralen, der Adickesallee und der Eckenheimer Landstraße, gewählt worden. Das Grundkonzept der Architekten orientierte sich demzufolge an städtebaulichen Gegebenheiten und Zwangen. Der Kerngedanke lag in der baulichen Schließung der Straßenkanten. Der Bibliotheksbau setzt sich aus mehreren Komplexen zusammen: ein Verwaltungstrakt mit den Arbeitsräumen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Eckenheimer Landstraße; in spitzwinkliger Form auf der anderen Seite des Grundstückes an der Schlosserstraße das Areal des Lesesaals; davor in Richtung Adickesallee der Kubus des Konferenztraktes. Lesesaal und Verwaltungstrakt ist auf der straßenabgewandten Seite der Bibliotheksgarten vorgelagert. Am Schnittpunkt der genannten Gebäudeteile liegt ein Vorplatz, eine "Piazetta". Von hier aus erschließt sich dem Besucher das zentrale Eingangsfoyer als Rotunde mit einer flachen, kuppelartigen Glasüberdachung. Die Architekten waren von Anfang an bemüht, ihre architektonische Sprache aus dem funktionalen Inhalt des Gebäudes zu entwickeln. Das gesamte Gebäude der Bibliothek soll nach dem Willen seiner Schöpfer dem Nützlichen und Zweckmäßigen verpflichtet sein. Quintessenz ist die Verbindung von Verwaltungsgebäude mit Lesesaallandschaft sowie Konferenzzentrum und Ausstellungsareal. Die Funktionen dieser unterschiedlichen Gebäudeteile bestimmen jene Formensprache, die Prof. Kaiser in seiner Rede anläßlich des Richtfestes am 13. September 1994 mit einem "Nebeneinander von hoch und niedrig, von Geschlossenheit zu den Straßen und Offenheit zum Garten . . . " als "durchgängiges Kompositionsprinzip" definierte. Daß sich das Gebäude trotz oder gerade deswegen relativ bescheiden ausnimmt, liegt nicht zuletzt daran, daß einer der Kernbestandteile der Bibliothek unter die Erde "verbannt" wurde. Die geringe Grundstücksgröße und konservatorische Überlegungen führten dazu, daß man den mit Abstand größten Teil des Gebäudevolumens unterirdisch anlegte. Die 30.000 qm des Magazins sind auf drei Untergeschosse verteilt. Ausgestattet mit einer Kompaktregalanlage, bietet es Raum für 18 Millionen Bände. Erst wenn man diesen nicht sichtbaren Teil des Gebäudes in die Betrachtung des Gesamtbauwerkes mit einbezieht, erschließen sich die wahren Dimensionen des Baus. Maßgebend für die äußere Gestalt des Gebäudeteils entlang der Eckenheimer Landstraße ist eine geschickte Anordnung der Bauteile zum Bibliotheksgarten hin, sowie die Abkehr der meisten Mitarbeiterräume und anderer funktionaler Bereiche von der lauten Straße hin zum ruhigen Garten. So ist dieser Gebäudetrakt zur Straße hin weitgehend geschlossen und zum Garten hin großzügig verglast, was für die Versorgung der Büroräume mit Tageslicht optimal ist. Großraumbüros wurden vermieden; die Mehrzahl der Raume sind als Zweierzimmer dimensioniert. Schnittpunkt aller Wege für die Benutzerinnen und Benutzer ist die Eingangshalle, die durch eine Glaswand den Blick in den Lesesaal ermöglicht. Geradeaus kommt man an der Buchsicherungsanlage vorbei in den Benutzungsbereich. Von hier aus links geht es zu den Online-Katalogen und der Bücherausgabe, rechts zum Informationszentrum und in den Lesesaalbereich. Der Lesesaaltrakt besteht aus drei Bereichen, dem im Sockelgeschoß gelegenen Multimedialesesaal, dem zentralen Lesesaalbereich (Hauptlesesaal) im Erdgeschoß und dem Zeitschriftenlesesaal, als eine Art über dem Hauptlesesaal schwebenden Galeriesystem. Zum Garten hin ist auch dieser Gebäudeteil über die gesamte Front verglast. Außerdem ist das Dach mit Oberlichtern versehen, die die Versorgung mit Tageslicht noch optimieren. Die zur Straßenseite ausgerichtete Lesesaalwand ist geschlossen und bietet Platz für einen Teil der Bücherregale der Freihandbibliothek, die insgesamt auf 80.000 - 100.000 Bande ausgelegt ist. Der Magazintrakt ist in drei großen Ebenen unterhalb des gesamten Areals angeordnet. In der Mitte jeder Magazinetage befindet sich ein sogenannter Stützpunkt, der an die zentrale Förderanlage angeschlossen ist. Sie verbindet sämtliche Abteilungen des Hauses sowie die Lesesäle und die Bücherausgabe. Diese Transportanlage ist eine Spezialanfertigung, eine Kombination von Teleliftsystem mit Paternosterförderern. Auf den Magazinetagen wird der Transport der Bücher in kleinen Elektrowagen erfolgen. Durch dieses Transportkonzept sollen die Bücher in einer angemessenen Zeit bereitgestellt und auch größere Buchtransporte innerhalb der Magazinbereiche realisiert werden. Die relativ geschlossenen Außenfronten des Bibliotheksgebäudes sind nur in den Erdgeschoßzonen auch zu den Straßen hin geöffnet. Dem Passanten offenbaren sich der Ausstellungssaal mit seiner Galerie, das Restaurant und die Eingangshalle, durch die man nicht nur in den Lesesaalbereich sondern auch durch ihn hindurch in den Bibliotheksgarten blicken kann. Alles in allem ist das neue Gebäude der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main kein Bau, der durch spektakulären oder gar übertrieben repräsentativen Charakter besticht. Seine Vorzüge liegen eindeutig in der Zweckmäßigkeit. Somit entzieht sich dieser Bau meiner Meinung nach den immer wieder angestellten Vergleichen mit anderen Nationalbibliotheken, wie im übrigen auch Die Deutsche Bibliothek nur schwer mit anderen Nationalbibliotheken verglichen werden kann. Im neuen Gebäude der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main werden neueste Computertechnik und ein elektronisches Hochgeschwindigkeitsnetz, an das fast alle PCs der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses angekoppelt sind, dafür sorgen, daß die Bibliothek den Herausforderungen des interaktiven Informationszeitalters gewachsen ist. Diesem Ziel dient auch ein speziell auf die Nutzung der neuen elektronischen Medien ausgelegter Multimedialesesaal. In allen Gebäudeteilen wurde größter Wert auf Flexibilität und Vernetzbarkeit gelegt. Das Einbringen von großzügig dimensionierten Kabelkanälen, Hohlraum- bzw. Sandwichböden und Kabelschächten ist die bauliche Voraussetzung dafür. Der gesamte Lesesaalbereich beispielsweise kann - neben den bereits ohnehin in der ersten Ausbaustufe vorgesehenen PC-Anschlüssen - bei steigendem Bedarf gänzlich verkabelt werden. Auch von Seiten der Hardware wurden alle Vorkehrungen getroffen, um flexibel auf steigende Anforderungen in der Zukunft reagieren zu können und innerhalb der Bibliothek den Zugriff auf interne und externe Datenspeicher und -netze zu ermöglichen. Das neue Gebäude der Deutschen Bibliothek in Frankfurt wird Platz für eine bessere Umsetzung traditioneller bibliothekarischer Arbeitsprozesse bieten. Darüber hinaus wird es alle Möglichkeiten einräumen, um mit Hilfe neuester Informationstechnologien, unter Nutzung technischer Innovationen möglichst viele Informationen, in welcher Form auch immer, an den Nutzer zu bringen. aus: Kolasa, I.: Dem Nützlichen und Zweckmäßigen verpflichtet. - In: Dialog mit Bibliotheken (1994) Sondernummer Der Neubau der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main, S. 9-11 |